Bezeichnung: Dopamin, Adrenalin (Epinephrin), Noradrenalin (Norepinephrin), Plasma-Katecholamine
Ähnliche Tests:

Wann werden Katecholamine untersucht?
Pixabay / jaytaix
Auf einen Blick
Inhaltsverzeichnis
Warum werden Katecholamine untersucht?
Um ein Phäochromozytom (einen Tumor der Nebennieren) oder einen anderen neuroendokrinen Tumor zu diagnostizieren oder auszuschließen.
Bei welchen Erkrankungen sollten Katecholamine untersucht werden?
Bei vorübergehend oder anhaltend hohem Bluthochdruck begleitet von schweren Kopfschmerzen, schnellem Puls und vermehrtem Schwitzen.
Aus welchem Probenmaterial werden Katecholamine bestimmt?
Aus einer Blutprobe, die aus einer Armvene gewonnen wird, oder aus 24-Stunden-Sammelurin.
Table of Contents
Katecholamine (Hormone)
Was wird untersucht?
Katecholamine sind eine Gruppe von verwandten Hormonen, die im Mark (dem zentralen Anteil) der Nebennieren produziert werden. Die Nebennieren sind kleine dreieckige Organe, die beiden Nieren aufsitzen. Die wichtigsten Katecholamine sind Dopamin, Adrenalin (Epinephrin) und Noradrenalin (Norepinephrin).
Diese Hormone werden bei körperlichem oder emotionalem Stress in den Blutkreislauf ausgeschüttet. Sie steigern die Übertragung von Nervenimpulsen in das Gehirn, die Freisetzung von Glucose und Fettsäuren (als Energiequellen), erweitern die Bronchiolen (kleine Luftwege in den Lungen) und die Pupillen.
Norepinephrin verengt weiterhin die Blutgefäße, um den Blutdruck zu erhöhen, und Adrenalin erhöht die Pulsrate und steigert den Stoffwechsel. Nach Erfüllung ihrer Aufgaben werden die Substanzen zu inaktiven Formen abgebaut.
Dopamin wird dabei zu Homovanillinsäure (HVA), Noradrenalin zu Normetanephrin und Vanillinmandelsäure (VMA) und Adrenalin wird zu Metanephrin und VMA abgebaut. Sowohl die Hormone als auch ihre Abbauprodukte werden mit dem Urin über die Nieren ausgeschieden.
Im Normalzustand sind Katecholamine und ihre Abbauprodukte in kleinen Mengen im Körper vorhanden. Nur während und kurz nach einer Stresssituation steigen sie z.T. deutlich an.
Dies kann zu dauerhaft hohem Blutdruck und/oder wiederholten Attacken starker Blutdruckanstiege führen und geht häufig mit einer entsprechenden Beschwerdesymptomatik einher. Die betroffenen Patienten verspüren starke Kopfschmerzen, Herzklopfen, Schweißausbrüche, Übelkeit, Angstgefühl, Kribbeln in Armen und Beinen.
Phäochromozytome
Etwa 90% der Phäochromozytome sind in den Nebennieren lokalisiert. Die meisten dieser Tumore sind gutartig, nur wenige bösartig. Das heißt, sie wachsen nicht in umliegende Organe ein und bilden keine Metastasen im Körper, auch wenn sie kontinuierlich an Größe zunehmen.
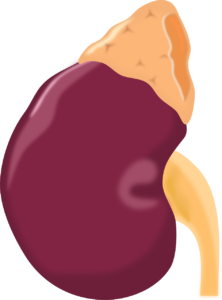
Niere & Nebenniere
Pixabay / OpenClipart-Vectors
Wird das Phäochromocytom nicht behandelt, so kann sich unter dem weiteren Tumorwachstum die klinische Symptomatik verschlechtern. Der vom Phäochromozytom verursachte Bluthochdruck kann wichtige Organe wie Nieren und Herz dauerhaft schädigen; das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte nimmt zu.
Die Untersuchung auf Katecholamine in Urin und Blut kann für die Diagnosestellung bei Phäochromozytomen hilfreich sein. Obwohl nach Angaben des National Cancer Institutes in den USA jährlich nur etwa 800 Fälle diagnostiziert werden, ist die Erkennung und Therapie dieser seltenen Tumoren wichtig, da mit Behandlung des Phäochromocytoms auch der gefährliche Bluthochdruck geheilt werden kann.
Meist können die Tumoren chirurgisch entfernt werden. Dadurch wird die Menge der produzierten Katecholamine erheblich reduziert, Beschwerden und Folgeschäden können vermindert oder gänzlich vermieden werden.
Bei der Bestimmung von Katecholaminen werden die Mengen von Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin in Plasma und Urin gemessen. (Die Abbauprodukte dieser Hormone können außerdem durch einen Metanephrin- und/oder VMA-Test im Urin bestimmt werden.) Beim Katecholamin-Test im Plasma wird die Menge bzw. Konzentration des Hormons gemessen, die sich im Moment der Blutentnahme im Kreislauf befindet. Die Urinuntersuchung hingegen misst die Hormonmenge, die im Verlauf von 24 Stunden ausgeschieden wird.
Das Probenmaterial
Wie wird das Probenmaterial für die Untersuchung gewonnen?
Für den 24-Stunden-Sammelurin wird der gesamte Urin über einen Zeitraum von 24 Stunden gesammelt. Dabei ist es wichtig, den Urin während dieser Zeit gekühlt zu lagern.
Da Ernährung, körperliche Betätigung und Medikamente die Katecholamin-Spiegel beeinflussen können, müssen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die Probe eine repräsentative Stoffwechsellage widerspiegelt. Daher sollten die Ernährung und einzunehmende Medikamente vorher besprochen werden.
Das Testergebnis kann auch von vielen Medikamenten beeinflusst werden. Sämtliche Medikamente (verordnete und frei verkäufliche) sowie Nahrungsergänzungsstoffe sollten deshalb ebenfalls ärztlich besprochen werden.
Sofern es möglich ist, sollten Medikamente, die den Test beeinflussen können vor und während der Sammelperiode weggelassen werden. Emotionaler und körperlicher Stress sowie starke körperliche Anstrengung sollten vor und während des Sammelzeitraums minimiert werden, da auch sie die Ausschüttung von Katecholaminen steigern können.
Die Blutprobe zur Bestimmung der Katecholamine im Plasma wird über eine Kanüle aus einer Armvene gewonnen. Obgleich es unterschiedliche Meinungen darüber gibt, wie diese Blutprobe entnommen werden sollte, ist es möglicherweise sinnvoll, den Patienten vor Entnahme 15-30 Minuten still liegen zu lassen und das Blut auch im Liegen zu entnehmen. Es ist aber auch möglich, dass der Patient während der Blutentnahme ohne eine vorherige Erholungsphase aufrecht sitzt.
Katecholamine Test
Wie wird der Test eingesetzt?
Die Bestimmung von Katecholaminen dient hauptsächlich der Diagnostik von Phäochromozytomen bei symptomatischen Patienten. Sie kann auch durchgeführt werden, um den Behandlungserfolg zu kontrollieren, nachdem bereits ein Phäochromozytom diagnostiziert und entfernt wurde, oder um Rückfälle auszuschließen.
Die Untersuchung aus Blut ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der Patient unter dauerhaftem Bluthochdruck leidet, oder sich akut in einer Phase hohen Blutdrucks befindet. Bei Blutentnahme außerhalb einer Hochdruckphase, d.h. wenn der Tumor gerade kaum Hormone abgibt, können sich die hohen Hormonkonzentrationen durch Abbau und Ausscheidung längst normalisiert haben.

Mit einer Untersuchung der Katecholaminen im Urin kann die Gesamtmenge von Katecholaminen ermittelt werden
Die Untersuchung von Katecholaminen im Urin misst dagegen die gesamte Menge von Katecholaminen, die über einen Zeitraum von 24 Stunden freigesetzt werden. Da die Hormonspiegel während dieser Zeit erheblich schwanken können, kann der Urintest eine vorübergehende Ausschüttung erfassen, die dem Bluttest entgehen könnte.
Der Plasma- und Urintest können einzeln oder zusammen und gemeinsam mit Urin- und/oder Plasma-Metanephrinen durchgeführt werden, um überschießende Mengen von Katecholaminen und ihren Abbauprodukten zu erfassen.
Da diese Tests von Ernährung, Medikamenten und Stress beeinflusst sind, kann es zu falsch positiven Ergebnissen kommen. Aus diesem Grund wird die Untersuchung von Katecholaminen nicht als Reihenuntersuchung für die gesamte Bevölkerung empfohlen. Ein Test mit positivem Ergebnis muss immer auf mögliche Einflussfaktoren hinterfragt und gegebenenfalls unter Minimierung aller Störfaktoren wiederholt werden, um das Ergebnis zu bestätigen.
Gelegentlich kann die Untersuchung auch sinnvoll sein, wenn bei einer bildgebenden Untersuchung als Zufallsbefund ein Nebennierentumor oder neuroendokriner Tumor entdeckt wurde oder Patienten eine positive Eigen- oder Familienanamnese von Phäochromozytomen haben, da diese rezidivieren können und in manchen Fällen einen genetischen Hintergrund haben.
Test – Wann sinnvoll?
Wann könnte der Test sinnvoll sein?
Katecholamine werden untersucht, wenn ein Phäochromozytom vermutet wird oder ausgeschlossen werden soll. Dies könnte der Fall sein, wenn Symptome wie ständiger oder wiederholt auftretender Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Erröten und hoher Puls bestehen. Ein weiterer Grund kann ein festgestellter Bluthochdruck sein, der nicht auf die üblichen Behandlungsmaßnahmen anspricht.
Der Test kann auch angefordert werden, wenn zufällig ein Nebennierentumor entdeckt wurde oder der Patient eine Familienanamnese von Phäochromozytomen hat. Er kann auch zur Überwachung des Therapieerfolgs genutzt werden, wenn ein Patient mit Phäochromozytom behandelt wurde.
Das Testergebnis
Was bedeutet das Testergebnis?
Da der Katecholamin-Test empfindlich ist für äußere Einflüsse und da Phäochromozytome selten sind, werden mehr falsch positive als richtig positive Ergebnisse beobachtet. Wenn ein Patient mit Bluthochdruck hohe Mengen von Katecholaminen im Blut und/oder Urin hat, sind weitere Untersuchungen notwendig.
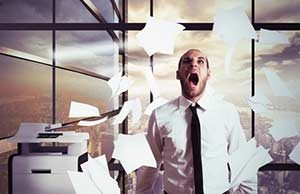
Stresssituationen können zu vorübergehenden Anstiege des Katecholaminspiegels führen
Schwere Erkrankungen und Stresssituationen können mäßige bis starke vorübergehende Anstiege der Katecholaminspiegel verursachen. Der Patient muss daher in seiner Gesamtheit, d.h. einschließlich körperlicher Verfassung, emotionalem Zustand, eingenommenen Medikamenten und Ernährung betrachtet werden.
Werden Störfaktoren ausfindig gemacht und können diese eliminiert werden, dann ist es oft sinnvoll den Test zu wiederholen, um das positive Ergebnis zu bestätigen oder zu widerlegen. Zusätzlich können die (freien) Metanephrine in Blut und/oder Urin bestimmt werden sowie bildgebende Untersuchungen (wie Magnet-Resonanz-Tomographie) durchgeführt werden, um das Ergebnis zu bestätigen.
Wenn die Katecholamine bei einem Patienten erhöht gefunden werden, der bereits wegen eines Phäochromozytoms behandelt wurde, ist anzunehmen, dass die Behandlung nicht ausreichend wirksam war bzw. ein Rückfall aufgetreten ist.
Wenn die Katecholamin-Spiegel in Blut und Urin normal sind, ist ein Phäochromozytom unwahrscheinlich. Allerdings produzieren Phäochromozytome nicht zwangsläufig permanent Katecholamine. Wenn der Patient daher seit einiger Zeit keinen Anfall von Bluthochdruck hatte, können die Katecholamin-Spiegel auch im Normbereich liegen, obwohl ein Phäochromozytom vorliegt.
Wissenswertes
Gibt es Weiteres, das ich wissen sollte?
Während die Katecholamin-Bestimmung in Plasma und Urin diagnostisch hilfreich für die Diagnosestellung eines Phäochromozytoms ist, erlaubt sie jedoch keine Aussage über die Lokalisation des Tumors, ob es einer oder mehrere Tumoren sind und ob der Tumor gutartig (in den meisten Fällen) oder aber bösartig ist.
Die Menge der freigesetzten Katecholaminen korreliert auch nicht zwingend mit der Größe des Tumors. Die freigesetzte Katecholaminmenge ist mit abhängig von der Zusammensetzung des Tumorgewebes. Allerdings nimmt in der Regel die Menge der produzierten Katecholamine zu, wenn der Tumor wächst.
Das Absetzen verordneter Medikamente sollte im Vorfeld immer mit dem Arzt besprochen werden. Im ärztlichen Gespräch können mögliche Störfaktoren identifiziert und danach festgelegt werden, welche Substanzen während der Untersuchung gefahrlos weggelassen werden können, welche jedoch unbedingt weiter genommen wer¬den müssen oder durch alternative Medikamente ersetzt werden können.
Einige Wirkstoffe, die eine Katecholamin-Bestimmung beeinflussen können sind:

Verschiedene Stoffe können die Katecholamin-Bestimmung beeinflussen
- Paracetamol,
- Aminophyllin,
- Amphetamine,
- Appetitzügler,
- Kaffee,
- Tee,
- andere Formen von Coffein,
- Chloralhydrat,
- Clonidin,
- Dexamethason,
- Diuretika,
- Epinephrin,
- Ethanol (Alkohol),
- Insulin,
- Imipramin,
- Lithium,
- Methyldopa,
- MAO-Hemmer (Monoaminoxidase-Inhibitoren),
- Nicotin,
- Nitroglycerin,
- Nasentropfen,
- Propafenon,
- Reserpin,
- Salicylate (z.B. Aspirin®),
- Theopyllin,
- Tetrazykline,
- trizyklische Antidepressiva
- und Vasodilatatoren.
Der Einfluss dieser Wirkstoffe auf die Katecholamin-Ergebnisse können von Patient zu Patient variieren und sind letztlich nicht vorhersehbar.
Hinweise & Störungen
Probenmaterial
24-h-Sammelurin mit Stabilisatorvorlage (10 ml 20%ige Salzsäure)
Stabilität und Probentransport
Stabilisierter Sammelurin (s.o.): 12 Mo bei -20°C bzw. 4-8°C; 3 Wo bei RT
Die biologische Halbwertzeit liegt bei wenigen Minuten, so daß das Material so schnell wie möglich bearbeitet, oder eingefroren werden sollte. Ohne Stabilisator sind Katecholamine maximal eine Stunde stabil.
Probentransport unter Einhaltung der Stabilitätsangaben.
Referenzbereich
Für diesen Test steht kein Standard-Referenzbereich zur Verfügung. Da die Referenzbereiche von vielen unterschiedlichen Faktoren, wie z.B. Alter, Geschlecht und Referenzpopulation beeinflußt werden, und darüber hinaus Methoden- bzw. Verfahrens-abhängig sind, sind die numerischen Testergebnisse zwischen verschiedenen Laboratorien nicht vergleichbar.
Störfaktoren und Hinweise auf Besonderheiten
Zentrifugation und Abtrennung des Plasmas binnen 15 min und Einfrieren bei -20°C empfohlen. Die Blutprobe sollte möglichst unmittelbar nach Entnahme zentrifugiert werden und das Plasma abgetrennt werden. Eingefroren sind die katecholamine stabil. Einfluss- und Störfaktoren wie oben aufgeführt.
Für die Bestimmung der Katecholamine im Plasma gibt es derzeit keine externe Qualitätskontrolle entsprechend der Richtlinien der Bundesärztekammer (RILIBÄK). Externe Ringversuche werden angeboten.
Häufige Fragen (FAQ)
Nachfolgend finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Katecholamine.
Kann man die Entstehung eines Phäochromozytoms verhindern?
Nein, Phäochromozytome können diagnostiziert und entfernt werden, ihre Entstehung kann man aber nicht vorbeugend verhindern. Meist ist der Tumor gutartig und führt nach Entfernung nicht zu Rückfällen.
Gibt es zu Hause durchführbare Katecholamin-Tests?
Nein, die Untersuchung muss mit Hilfe eines Spezialapparates in einem Labor durchgeführt werden.
Muss der Urin wirklich über 24 Stunden gesammelt werden?
Ja, für ein exaktes Ergebnis ist es äußerst wichtig, den gesamten Urin über 24 Stunden zu sammeln. Da die Katecholamine zu verschiedenen Zeiten freigesetzt werden, kann eine einzige nicht mitgesammelte Probe ausgerechnet die sein, die die meisten Katecholamine enthält.
Kann die psychische Verfassung das Testergebnis beeinflussen?
Ja, da Katecholamine aus den Nebennieren als Antwort auf Stress freigesetzt werden. In Angstsituationen kann die Konzentration von Katecholaminen erhöht sein.
Weiterführende Links
Weiterführende Informationen zum Thema.
- AWMF Leitlinien Phäochromozytom, Diagnostik und operative Therapie:
https://www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ll-na/003-005.htm - Leitlinien zur Diagnostik und Therapie der Hypertonie. Deutsche Hochdruckliga und Deutsche Hypertonie Gesellschaft:
https://www.paritaet.org/rr-liga/Hypertonie-Leitlinien05.pdf