Plasmozytom (Multiples Myelom)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Plasmozytom (Multiples Myelom)
- 2 Was ist ein Plasmozytom?
- 3 Diagnose & Krankheitsverlauf
- 4 Häufigkeit & Diagnosedaten
- 5 Komplikationen & Folgen
- 6 Wann zum Arzt?
- 7 Behandlung & Therapie
- 8 Vorbeugung & Prävention
- 9 Prognose zur Heilung
- 10 Plasmozytom Geschichte
- 11 Alternative Medizin
- 12 FAQ – Fragen & Antworten
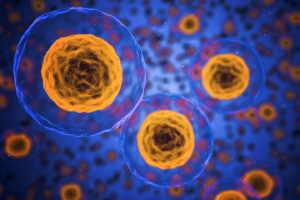
Pixabay / qimono
Bei dem Plasmozytom, häufiger: Multiples Myelom, handelt es sich um eine seltene, bösartige Tumorerkrankung des Knochenmarks. Der genaue Auslöser ist unbekannt, die Verbreitung erfolgt jedoch durch einen malignen Zellklon. Eine Plasmazelle entartet und verbreitet mehrere gleichartige Klone im Knochenmark.
Symptome werden entweder durch die Bildung der Antikörper und deren Eigenschaften oder aber durch das vermehrte bösartige Wachstum der Zellen ausgelöst. Patienten klagen über Knochenschmerzen, Gewichtsabnahme, Abgeschlagenheit und Erhöhte Temperatur.
Steckbrief: Plasmozytom
- Name(n): Plasmozytom; Multiples Myelom; Morbus Kahler; Huppert-Krankheit
- Art der Krankheit: bösartige (maligne) Tumorerkrankung (Gruppe: Non-Hodgkin-Lymphom)
- Verbreitung: 4-6 Erkrankungen/100.000 jährlich
- Erste Erwähnung der Krankheit: 1850 in einem Fallbericht des Arztes Macintyre (Patient: Thomas A. McBean)
- Behandelbar: keine vollständige Heilung möglich
- Art des Auslösers: unbekannt (Zellklon)
- Wieviele Erkrankte: 75.000 Patienten (2015)
- Welchen Facharzt sollte man aufsuchen: Onkologie
- ICD-10 Code(s): c90.0
Table of Contents
Definition Plasmozytom
Das Plasmozytom gehört zu den Tumorerkrankungen der Non-Hodgkin–Lymphom-Gruppe. Genau genommen handelt es sich um ein niedrig-malignes B-Zell-Lymphom. Charakterisiert wird die Erkrankung durch eine Vermehrung vom Plasmazellen innerhalb des Knochenmarks – ausgehend von einer einzelnen entarteten Zelle.
Die Produktion von Antikörpern der Plasmazellen ist charakteristisch, wobei selbige die Auslöser für verschiedene Erkrankungen sein können. Die Erkrankung ist sehr selten, dennoch gehört das Multiple Myelom zu den häufigsten Tumoren von Knochenmark und Knochen.
Männer sind von der Tumorerkrankung häufiger betroffen als Frauen. Am häufigsten erkranken Menschen zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr, wobei die Krankheit bei unter 35-jährigen sehr selten ist.
Erste Anzeichen sind häufige Infektionskrankheiten und Anämien. Im Verlauf kommt es zu Funktionsstörungen der Organe, Durchblutungsstörungen und vermehrten Knochenbrüchen. Das Multiple Myelom ist bislang nicht vollständig heilbar.
Was ist ein Plasmozytom?
Das Multiple Myelom tritt selten auf. Nur ein Prozent der neu entstehenden Tumorerkrankungen sind Plasmozytome. Rund 5 Menschen von etwa 100.000 erkranken jährlich. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch eines Plasmozytoms.
Mehrere Tumorherde im Knochenmark sind für diese Erkrankung üblich. Non-Hodgkin-Lymphome erhalten ihren Namen durch ihren Ursprung, der im lymphatischen System liegt. So sind auch bei Plasmozytomen die Lymphozyten betroffen.
Erkrankungen von Plasmazellen im Lymphsystem
Bei dem lymphatischen System handelt es sich um die Lymphbahnen, die durch den Körper laufen sowie lymphatische Organe. Dazu gehören einerseits die Lymphknoten uns andererseits die Thymusdrüse sowie die Milz. Im Rachen und Magen–Darm-Trakt ist ebenfalls lymphatisches Gewebe vorhanden.
Selbige sind für die körpereigene Abwehr zuständig. Die von den Plasmazellen gebildeten Antikörper bei einer Plasmozytom-Erkrankung erfüllen hingegen keine Funktion, schwächen allerdings das Immunsystem und führen vermehrt zu Infekten beim Patienten.
Charakteristik und Beschwerden
Charakteristisch ist, dass Plasmozytome oftmals zu Beginn kaum Beschwerden verursachen. Häufig sind Symptome unspezifisch und können verschiedensten Erkrankungen zugeschrieben werden. Aus diesem Grund ist es häufig schwierig, die Erkrankung frühzeitig zu diagnostizieren.
Bei der Verbreitung der Tumorzellen im Verlauf der Krankheit nimmt die Zellmasse zu, was beim Patienten zu Knochenschmerzen und damit einhergehendem Knochenabbau oder Knochenschwund führt. Zudem werden sie instabil und brüchig. Behandelt wird das Plasmozytom häufig erst bei Verursachung von Beschwerden.
Eine Heilung ist zwar nicht möglich, allerdings haben sich in den letzten Jahren verschiedene Methoden entwickelt, die zu einer deutlichen Steigerung der Lebensqualität des Patienten führen. So kann die Überlebungsquote nach Diagnosestellung um mehrere Jahre erhöht werden.
Ursachen & Auslöser
Die Entstehungsursachen für ein Plasmozytom sind unbekannt. Bei vielen Non-Hodgkin-Lymphomen sind eine geschwächte Immunabwehr oder bestimmte Virusinfektionen der Grund für den Krankheitsausbruch. Beim Plasmozytom hingegen scheint das nicht der Fall zu sein.
Entartung von Plasmazellen durch Zellklonung
 Gesichert ist, dass Plasmozytome von einer einzelnen entarten Zelle ausgehen, die zu einer Vermehrung von gleichartigen Plasmazellen führt. Diese vermehren sich bösartig im Knochenmark und führen wiederum zu einer übermäßigen Produktion von Immunglobinen – also Antikörpern. Diese Antikörper sind für das Immunsystem jedoch nutzlos und werden als monoklonale Antikörper oder Paraproteine bezeichnet.
Gesichert ist, dass Plasmozytome von einer einzelnen entarten Zelle ausgehen, die zu einer Vermehrung von gleichartigen Plasmazellen führt. Diese vermehren sich bösartig im Knochenmark und führen wiederum zu einer übermäßigen Produktion von Immunglobinen – also Antikörpern. Diese Antikörper sind für das Immunsystem jedoch nutzlos und werden als monoklonale Antikörper oder Paraproteine bezeichnet.
Das stetig wachsende bösartige Gewebe sorgt im Krankheitsverlauf für eine Verdrängung des blutbildenden Gewebes, was zu der für die Erkrankung repräsentative Blutarmut (Anämie) führt. Normalerweise durchlaufen Plasmazellen im gesunden Zustand einen Reifungsprozess, wenn sie durch ein Antigen wie Bakterien oder Viren stimuliert werden.
Im Verlauf dieser Entwicklung lernen sie, Antikörper zu bilden, die die Feinde bekämpfen. Im Gegenzug verlieren sie die Möglichkeit zur Zellteilung. Dieser Prozess wird durch die Entartung beim Ausbruch der Krankheit verhindert und verändert.
Diskussionspunkte: Äußere Einflüsse vs. Erbkrankheit
Bekannt ist, dass Multiple Myelome in einigen Familien gehäufter auftreten. Dies spricht für eine erbliche Vorbelastung, wobei es nicht ausreichend Fälle gibt, um diese Vermutung sicher zu belegen. Demnach ist auch unklar, inwieweit sich erbliche Faktoren auswirken und welche Gene für eine mögliche Weitervererbung verantwortlich sein könnten.
Das Multiple Myelom zählt nicht zu den typischen Erbkrankheiten. Zurzeit wird noch ermittelt, ob chemische Mittel und radioaktive Strahlung Tumoren im Knochenmark und die Entartung von Plasmazellen begünstigen. Im Verdacht stehen besonders Pestizide, also Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen. Aber auch elektromagnetische Strahlen könnten Risikofaktoren sein.
Symptome & Anzeichen
Wie bereits aufgegriffen, sind die Symptome, die ein Plasmozytom auslöst, vor allem zu Krankheitsbeginn sehr unspezifisch. So kommt es zunächst zu Abgeschlagenheit und Müdigkeit, die unter anderem von der übermäßigen Antikörperproduktion herrührt. Zudem schwächt das Wachstum des Tumors den Körper.
Daneben kommt es durch die Verdrängung des blutbildenden Gewebes zu einer Blutanämie, die wiederum Erschöpfungssymptome auslöst. Die Bildung der Antikörper sorgt daneben unter anderem für eine Erhöhung der menschlichen Körpertemperatur, da der Körper vermeintlich gegen die Tumorzellen zu kämpfen beginnt.
Auf der anderen Seite schwächt der Prozess das Immunsystem und sorgt somit dafür, dass der betroffene Patient häufiger an Infektionskrankheiten erkrankt. Der Grund hierfür ist auch, dass die produzierten Antikörper nicht mehr abwehrfähig sind. Der Körper kann sich mit eindringenden Fremdkörpern wie Bakterien oder Viren schlechter auseinandersetzen und es kommt zu Infekten.
Andere Anzeichen sind eine Gewichtsabnahme und nächtliche Schweißausbrüche. Beides kann jedoch ebenso auch bei anderen Erkrankungen auftreten. Die Folge des Knochenmarkbefalls sind Knochenschmerzen, die bei Bewegung deutlich zunehmen können. Diese treten oftmals durch unbemerkte Knochenbrüche auf. Häufig klagen Patienten über Rückenschmerzen.
Zufällige Diagnosestellung
Aufgrund der vielfältigen anderen Erkrankungen, die solche Symptome auslösen, wird das Plasmozytom oftmals zufällig entdeckt. So können im Urin bestimmte Proteine nachgewiesen werden, die auf eine Schädigung der Nieren hindeuten.
Im weiter fortgeschrittenen Krankheitsstadium sind Nierenfunktionsstörungen nicht selten. Zudem ist der Kalziumspiegel im Blut möglicherweise erhöht. Auch Übelkeit und Erbrechen können auftreten. Ebenso wie vermehrter Harndrang und eine Verdickung des Blutes.

Typische Symptome sind Müdigkeit und Abgeschlagenheit
Pixabay / nastya_gepp
Letzteres ist zudem der Auslöser für Durchblutungsstörungen, die sich einerseits in einer Minderdurchblutung einzelner Gliedmaßen und andererseits in Funktionsstörungen lebenswichtiger Organe zeigen können. Infarkte sind möglich.
Häufige Symptome auf einen Blick
- Müdigkeit und Abgeschlagenheit
- Knochenschmerzen
- Rückenschmerzen
- häufige Infektionskrankheiten
- nächtliches Schwitzen (Nachtschweiß)
- erhöhte Körpertemperatur
- Gewichtsabnahme
Diagnose & Krankheitsverlauf
Häufig wird ein Plasmozytom zufällig diagnostiziert. Auffällige Befunde bei Blut– oder Urinuntersuchungen liefern erste Angriffspunkte zur Diagnosestellung. Eiweißerhöhungen oder eine sehr hohe Blutsenkungsgeschwindigkeit sind erste Anzeichen, die vom Mediziner weiter abgeklärt werden müssen. Einen anderen Ansatz liefern Patienten, die über Knochenschmerzen klagen.
Röntgenuntersuchungen können Schädigungen im Knochenapparat zeigen. Bei Verdacht auf ein Multiples Myelom wird der Arzt eine Knochenmarkpunktion durchführen, Röntgenaufnahmen des gesamten Skeletts anordnen und die Zusammensetzung des Eiweiß im Blut und Urin überprüfen.
Knochenmarkpunktion
Bei einer Knochenmarkpunktion handelt es sich um eine Untersuchung, bei der dem Patienten unter örtlicher Betäubung mit einer hohlen Nadel geringe Mengen des Knochenmarks entnommen werden. Die Untersuchung wird häufig im Bereich des Beckens durchgeführt. Die entnommene Probe wird unter dem Mikroskop untersucht. Dabei können Zellveränderungen sicher festgestellt werden.
Serum-Eiweiß-Elektrophorese
Bei der Urin– und Blutuntersuchung wird eine sogenannte Serum-Eiweiß-Elektrophorese durchgeführt. Eiweißarten werden dabei voneinander separiert und der Arzt kann feststellen, wie viele verschiedene Eiweißkörper nachweisbar sind.
Typisch für ein Plasmozytom ist, dass große Mengen gleicher Typen aufzufinden sind. Paraproteine und Leichtkettenproteine gehören zu den oft nachgewiesenen Eiweißtypen, die sich bei einer Erkrankung mit einem Multiplen Myelom in Blut beziehungsweise Urin wiederfinden.

Bildgebende Verfahren wie z. B. das CT können aufschlussreich sein
Bildgebende Verfahren
Neben Röntgenaufnahmen kann auch eine Computertomografie Klarheit schaffen. Dadurch ist es möglich, die Auflösung von Knochen auch in geringer Menge detailliert darzustellen. Eine Magnetresonanztomographie (MRT) zeigt möglicherweise Tumoren im Wirbelsäulenbereich an und hilft bei deren Beurteilung.
Zusätzlich kann eine Blutuntersuchung auf verschiedene Blutsalze und eine Untersuchung der Nierenwerte dabei helfen, das Stadium der Erkrankung zu ermitteln.
Stadieneinteilung
- 1. Stadium: keine Kalziumauffälligkeiten im Blut, höchstens eine Osteolyse (Knochenabbau), Hämoglobin > 10 g/dl, Leichtkettenausscheidung (Urin)
- 2. Stadium: Zwischenstadium
- 3. Stadium: mindestens eines der Kriterien muss erfüllt sein: Hämoglobin 3,0 mmol/l, mehr als zwei Osteolysen, Leichtkettenausscheidung (Urin) > 12 g/24h
Häufigkeit & Diagnosedaten
Bei Betrachtung aller jährlich auftretenden Tumorerkrankungen findet sich das Plasmozytom eher selten. Nur 1 % aller diagnostizierten Tumoren sind Multiple Myelome. Dennoch gehört es zu den am häufigsten auftretenden Tumorerkrankungen des Knochenapparats.
Zwischen vier und sechs Menschen unter 100.000 erkranken jährlich. In Deutschland beträgt die jährliche Anzahl an Neuerkrankungen im Schnitt 3.000. Bei 75.000 Menschen weltweit war im Jahr 2015 eine Plasmozytom-Erkrankung bekannt.
Geschlechterdifferenz
Männer erkranken häufiger als Frauen, wobei die Quellen sich in dem Verhältnis uneinig sind. Während einige von einer doppelt so hohen Erkrankungshäufigkeit bei Männern sprechen, schreiben andere von einer lediglich um 10 % verringerten Auftrittshäufigkeit beim weiblichen Geschlecht.
Erkrankungsalter
Ab dem 50. Lebensjahr steigt die Anzahl der Erkrankungen deutlich an. Nur wenige sind jünger als 35 Jahre und nur 2 % der Betroffenen haben das 40. Lebensjahr noch nicht erreicht. Bei Kindern treten Plasmozytome fast nie auf. Der Erkrankungsdurchschnitt liegt bei 71 Jahren bei Männern. Frauen sind im Medial 73 Jahre alt.
Komplikationen & Folgen
Je nach Verlauf der Erkrankungen können verschiedene Komplikationen auftreten. So können beispielsweise vermehrt auftretender Harndrang oder durch das Plasmozytom begünstigte Schlafstörungen zu einer massiven Einschränkung des Tagesablaufes führen. Abgeschlagenheit und Müdigkeit führen dazu, dass die Patienten ihrem Alltag oftmals nur bedingt nachgehen können.

Die Knochen verlieren durch den Befall nicht nur an Stabilität, sondern auch an Festigkeit. Untersuchungen von Knochenfragmenten betroffener Verstorbener haben ergeben, dass bei ausbleibender Behandlung die Knochen mit bloßer Hand zerbrochen oder gar mit einem Messer zerschnitten werden konnten.
Auf Röntgenbildern sichtbare, poröse Stellen sind anfällig für Brüche. Geringe Belastungen und sportliche Aktivitäten können zu Knochenbrüchen führen, die wiederum die typischen Knochenschmerzen bedingen können.
Organe
Die Knochenentkalkung sorgt für den Anstieg des Kalziumgehaltes im Blut. Dadurch werden wiederum die Nieren geschädigt. Eine mögliche Komplikation ist, dass die Niere nicht mehr ausreichend arbeitet. Zudem kann es zu Nierenversagen kommen. Die Verdickung des Blutes durch die Zunahme des Gehaltes an Eiweiß ist daneben der Auslöser für eine schlechtere Durchblutung des Körpers.
Wichtige Organe wie das Herz oder das Gehirn können betroffen sein. Infarkte, Herzversagen oder Hirnschläge sind eine mögliche Folge. Abgesehen davon klagen aufgrund der mangelnden Hirndurchblutung viele Patienten über Seh- oder Hörstörungen. Andere berichten von Ohnmachtsanfällen.
Psychische Aspekte
Bei Tumorerkrankungen spielt grundsätzlich die psychische Komponente eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund werden Hilfegruppen für Erkrankte angeboten und selbige finden sich nicht selten in Gruppen zusammen, um mit ihrer Krankheit umzugehen zu lernen.
Werden Patienten von Tumorerkrankungen wie dem Plasmozytom nicht psychologisch unterstützt, kann dies ebenfalls zu Komplikationen führen. Auf der einen Seite kann der verstärkte psychische Druck die Krankheitssymptome und den körperlichen Abbau zusätzlich bestärken und auf der anderen Seite kapseln die Menschen sich nicht selten von ihrem Umfeld ab.
Der Grund dafür kann die Angst vor dem Leid der Angehörigen sein, aber auch die eigene Verzweiflung, die zu Sinnlosigkeitsgefühlen führt. In akuten Fällen sind Krebskranke eine Gefahr für sich selbst. Nicht selten kommt es zu Suizidversuchen oder Suiziden.
Wann zum Arzt?
Wann sollte man zum Arzt gehen?
Da bei Plasmozytomen vor allem verschiedene unspezifische Symptome auftreten, führt der erste Gang bei Beschwerden den Patienten nicht zum Onkologen, sondern zum Allgemeinmediziner. Je nach Symptom ist es auch möglich, dass Patienten zunächst einen Orthopäden aufsuchen. So zum Beispiel, um Schmerzen des Bewegungsapparates, des Rückens oder der Knochen abklären zu lassen.
Grundsätzlich sollten länger anhaltende Schmerzen ohne ersichtlichen Grund grundsätzlich ärztlich untersucht werden. Selbstredend ist nicht jeder Bewegungsschmerz auf ein Plasmozytom zurückzuführen. Verdacht auf Knochenbrüche gehören ebenso vom Arzt abgeklärt wie ständige Müdigkeit.
Ein ernstzunehmendes Symptom ist außerdem unerklärlicher und unbeabsichtigter Gewichtsverlust. Nicht selten ist er eine Begleiterscheinung verschiedener Tumorerkrankungen, wobei ihm oft auch andere körperliche oder psychische Ursachen zugrunde liegen können. Bei Unsicherheit wegen auftretender Beschwerden ist der Allgemeinmediziner oder Internist die erste Anlaufstelle.
Behandlung & Therapie
Ein Plasmozytom ist zwar in der Regel nicht heilbar, kann aber über verschiedene Therapiemethoden eingedämmt werden. So ist es möglich, den Allgemeinzustand des Patienten zu verbessern und sein Wohlbefinden zu erhöhen.
Wann ist eine Therapie sinnvoll?
Nicht immer wird der Arzt umgehend eine Behandlung einleiten. Wird die Erkrankung zufällig bei einer Routineuntersuchung festgestellt und befindet sich noch im Anfangsstadium, ist es in einigen Fällen so, dass der Krankheitsverlauf zunächst beobachtet wird.
Dies ist besonders dann der Fall, wenn das Plasmozytom bislang keine Beschwerden beim Betroffenen ausgelöst hat. Der Mediziner wird in solchen Fällen die Situation zunächst beobachten und abwarten, da die Behandlung den Körper des Patienten zusätzlich schwächen kann.
 Therapiemaßnahmen werden zumeist dann eingeleitet, wenn bereits Schäden aufgetreten sind:
Therapiemaßnahmen werden zumeist dann eingeleitet, wenn bereits Schäden aufgetreten sind:
- erhöhte Kalziumwerte
- Blutanämie
- Abnutzung oder Schwund von Knochenteilen
- Funktionsstörung der Nieren
Diese Punkte werden als CRAB-Kriterien bezeichnet. „Hpercalcemia“ steht für den erhöhten Kalziumspiegel, „renal insuffiency“ für Niereninsuffizienz, „anemia“ für Blutarmut und „bone lesions“ für die Knochenbeeinträchtigung. Unumgänglich ist eine Therapie außerdem dann, wenn andere Organe geschädigt wurden oder der Patient über häufige Infekte klagt, die den Körper wiederum stark belasten. Demnach ist der subjektive Gesundheitszustand des Patienten wichtig, um abzuklären, wann welche Therapiemaßnahme sinnvoll ist.
Chemo & Stammzellen
Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation
Bei der Therapie des Multiplen Myeloms kommt es auf das biologische Alter des Patienten an. Die Standardbehandlung von Patienten, die das 70. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, ist eine hochdosierte Chemotherapie mit einer Stammzelltransplantation.
Lässt der allgemeine Gesundheitszustand des Erkrankten es zu, können auch ältere Patienten noch mit dieser Methode behandelt werden. Durch die Chemotherapie werden die Krebszellen zerstört.
Da Chemotherapeutika allerdings auch die Stammzellen im Knochenmark angreifen, wird die körpereigene Immunabwehr angegriffen. Um dem entgegenzuwirken, werden dem Erkrankten zuvor entnommene Stammzellen wieder zugeführt. Das Ziel ist es, das blutbildende System auf diese Weise wieder neu aufzubauen.
Allogene Stammzelltransplantation als Risikotherapie
In seltenen Fällen, besonders dann, wenn die autologe Stammzelltransplantation keinerlei Erfolg gebracht hat, kann der Arzt abwägen, ob die Stammzellspende eines gesunden Spenders eine Therapiemöglichkeit darstellt.
Auf diese Weise ist in der Theorie eine vermeintliche Heilung möglich. Allerdings ist diese Therapiemethode mit hohen Risiken verbunden.
So kann es passieren, dass das Immunsystem des Spenders sich gegen die Organe des Erkrankten richtet und so den Körper weiter zerstört. Insbesondere bei jüngeren Patienten ist diese Behandlungsmethode in Erwägung zu ziehen, da selbige mögliche Folgen in der Regel besser verkraften.
Weitere Maßnahmen
Behandlung mit neuen Substanzen
Zusätzlich zur Chemotherapie und der Behandlung mit Stammzellen haben sich in den letzten Jahren verschiedene Stoffe bewährt, die als „neue Substanzen“ bezeichnet werden. Dazu gehören Bortezomib, Thalidomid und Lenalidomid.
Dabei handelt es sich um Mittel, die das Immunsystem des Erkrankten beeinflussen. Sie sind immunmodulierend. Allerdings ist die Anwendung von Thalidomid bis heute umstritten, da der Stoff eine fruchtschädigende Wirkung hat.
Bortezomib sorgt hingegen zwar dafür, dass Tumorzellen besser auf die Behandlung ansprechen, ist aber andererseits bekannt dafür, Polyneuropathien auszulösen. Bringen diese Medikamente keinen Erfolg, ist auch der Einsatz von Pomalodomid denkbar. Er hat weniger Nebenwirkungen, funktioniert jedoch ähnlich.
Antikörperbehandlung und Strahlentherapie
Je nach Fall ist es möglich, dass eine Therapie mit Antikörpern gute Ergebnisse erzielt. Diese haben eine zellschädigende Wirkung und können Antigene auf Tumorzellen ausmachen. So besteht auch die Chance, dass die bösartigen Zellen von den Antikörpern angegriffen werden. Auf der anderen Seite ist das Plasmozytom strahlenanfällig. Allerdings ist eine Strahlentherapie örtlich begrenzt und sollte daher nur in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden angewendet werden.
Operationen
Zwar stellt eine Operation keine Therapiemöglichkeit in dem Sinne dar, trotzdem kann es nötig sein, spontane Knochenfrakturen zu operieren, um Komplikationen zu verhindern. Damit die Brüche keine Nervenverletzungen oder gar Lähmungen auslösen und die Beweglichkeit von Gliedmaßen wiederhergestellt werden kann, ist eine Operation in manchen Fällen kaum zu vermeiden.
Remission als Behandlungsziel
Ärzte arbeiten bei Behandlung von Multiplen Myelome auf eine sogenannte Remission hin. Als solche wird das Zurückdrängen der Erkrankung bezeichnet. Sie ist im Blut nicht mehr nachweisbar und wird so in einen Ruhezustand versetzt. In den letzten Jahren hat die Medizin große Fortschritte in diesem Bereich zu verzeichnen gehabt und die Lebenserwartung der Patienten steigt an.
Vorbeugung & Prävention
Es ist nicht möglich, der Erkrankung an einem Multiplen Myelom vorzubeugen. Da nicht bekannt ist, wodurch die Tumorerkrankung ausgelöst wird, ist auch das Treffen von Vorsichtsmaßnahmen nicht möglich. Ebenso wenig gibt es einen Impfstoff, durch den der Ausbruch der Tumorerkrankung verhindert werden könnte.
Aufgrund des Verdachts einer erblichen Häufung ist es jedoch sinnvoll, wenn Personen mit betroffenen Familienmitgliedern besonders beim Auftreten unerklärlicher Symptome selbige zeitig abklären lassen. Der Kontakt zu Schädlingsbekämpfungsmittel sollte vermieden werden, da eine geringe Chance besteht, dass selbige die Entstehung eines Plasmozytoms begünstigen.
Prognose zur Heilung
In den letzten Jahren hat die Forschung die Prognose bei Multiplen Myelomen deutlich verbessert. Kann die Krankheit mit entsprechender Behandlung zu einem vorläufigen Stillstand gebracht werden, können Patienten noch mehrere Jahre weitgehend beschwerdefrei leben.
Hierbei kommt es allerdings darauf an, wie der Körper des Patienten auf die Therapieformen anspricht. Hinzu kommt, dass bei vielen Patienten der Tumorherd lange inaktiv sein kann, bis die Erkrankung wirklich ausbricht und Beschwerden verursacht. Eine genaue Angabe zur Prognose ist aus diesem Grund nur schwer möglich.
Während einige Erkrankte bereits nach wenigen Monaten starben, lebten andere bei entsprechender Therapie noch über zehn Jahre. Der Mittelwert bei einer Chemotherapie liegt heute bei etwa fünf Jahren, während sie vor der Einführung der Chemotherapie bei lediglich einem Jahr lag.
Die Frage lässt sich pauschal nicht beantworten. Die Prognose ergibt sich aus dem individuellen körperlichen Zustand des Patienten, dessen Alter und dem Stadium der Erkrankung sowie deren Verlaufsgeschwindigkeit.
Viele Menschen leben einige Jahre, ohne Beschwerden zu haben. Bei anderen verläuft das Plasmozytom nach wenigen Monaten tödlich. Anhand der neuesten medizinischen Möglichkeiten können Patienten eines Multiplen Myeloms aber durchaus weitere zehn bis fünfzehn Jahre nach Diagnosestellung leben.
Plasmozytom Geschichte
Geschichte des Multiplen Myeloms
Plasmozytome gibt es nicht erst seit den letzten paar Jahrhunderten. Knochenfunde zeigen, dass die Erkrankung bereits im 2. Jahrhundert vor Christus aufgetreten ist und Menschenleben gekostet hat. So wiesen entsprechende Funde dieselbe Brüchigkeit auf, die heute als typisches Anzeichen für das Plasmozytom gilt.
Gut dokumentierte Fälle finden sich jedoch erst im 19. Jahrhundert. So auch von dem englischen Händler Thomas MacBean, bei dem ein Plasmozytom bereits mit 45 Jahren auftrat. Mit entsprechenden Symptomen suchte er verschiedene Ärzte auf.
Da die behandelnden Ärzte mit den Symptomen und dem Krankheitsverlauf zu dieser Zeit wenig anfangen konnten, starb der Patient im darauffolgenden Jahr. In seiner Todesurkunde wurde Bewebsschwund und Proteinausscheidung im Urin als Ursache angegeben, was heute vielmehr als Symptom gilt.
Bei der späteren Obduktion wurden unter anderem Löcher in den Knochen festgestellt. Selbige waren mit einer Masse gefüllt, welche sich unter dem Mikroskop als Krebszellen herausstellte. Auffällig ist, dass die Erkrankung inzwischen häufiger auftritt, als es noch vor drei Jahrzehnten der Fall war.
Alternative Medizin
Alternative Behandlungsmethoden beim multiplen Myelom
Nicht nur die Schulmedizin beschäftigt sich mit der Therapie von Krebserkrankungen. Immer mehr Menschen schwören ergänzend auch auf die Kraft von alternativen Heilmethoden. Ein Vorteil dieser Optionen besteht darin, dass sie den Körper oftmals weniger stark belasten. Trotzdem können auch im Kampf gegen Tumoren wie Plasmozytome so gute Effekte erzielt werden.
Biologische und alternative Therapieverfahren des Hyperthermie-Zentrums
Mögliche alternative Therapiemöglichkeiten schlägt beispielsweise das Hyperthermie-Zentrum in Hannover vor.

Pixabay / bekaschiller
So können folgende Behandlungen Erfolg bei der Behandlung von Multipen Myelomen bringen:
- Hyperthermie des gesamten Körpers
- Bioresonanz-Therapie
- Wega-Test
- Gerson-Therapie
- Ernährungsumstellung
- Hochdosiertes Vitamin C
- Kaffee-Einläufe
- Vitamin B17
- Weitere Infusionen
Naturheilkundliche Therapie
Aufgrund der starken Nebenwirkungen und Risikofaktoren einer schulmedizinischen Chemo- und Stammzelltherapie können naturheilkundliche Verfahren angewendet werden, um die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder zu regenerieren und zu unterstützen.
Hierzu gehören:
- Misteltherapie
- Meditation
- Orthomolekulare Medizin
Plasmozytom Hausmittel
Hilfreiche Hausmittel beim multiplen Myelom
Es gibt keine Hausmittel, um ein Plasmozytom zu behandeln. Allerdings besteht die Möglichkeit, Symptomen zusätzlich mit verschiedenen Hausmitteln beizukommen. So kann auch das Wohlbefinden des Patienten verbessert werden. Dies gilt insbesondere für psychische Probleme, die mit der Krankheit einhergehen.
Gesunde Ernährung und Bewegung
Immer vom Arzt verordnet, wird der Effekt von gesunder Ernährung und dazugehöriger Bewegung oft unterschätzt. Ermöglicht die Erkrankung es, können tägliche Spaziergänge dabei helfen, die Stimmung das Patienten zu verbessern. Dafür sorgen auch die frische Luft und die Glückshormone, die durch Sonneneinstrahlung im Körper gebildet werden.
Eine gesunde Ernährung kann den Körper ebenso beim Kampf gegen ein Plasmozytom unterstützen. Mineralstoffe und Vitamine erhalten den Körper und helfen dabei, Infektionen, die mit der Krankheit einhergehen, zu bekämpfen. Daneben kann der Verzehr von kleineren Mengen Schokolade dabei helfen, die Stimmung zu verbessern.
Beruhigung durch Pflanzenkraft
Johanniskraut ist nicht nur seit Jahrhunderten ein Mittel, das gegen Depressionen und psychische Verstimmungen hilft. Der Pflanze wird zudem nachgesagt, dass sie gegen Viren und Entzündungen vorgeht und sogar das Tumorwachstum verschiedener Krebsarten behindern soll.
Daneben findet auch Baldrian seine Anwendung in der Nervenberuhigung. Inwieweit es zu Wechselwirkungen mit Medikamenten kommen kann, sollte im Einzelfall vorher jedoch mit dem Arzt abgeklärt werden. Hierzu gibt es unterschiedliche Studien, die teilweise konträre Ergebnisse brachten.
Heilkräuter & Heilpflanzen
Auch bestimmte Heilpflanzen und Heilkräuter können die Behandlung eines multiplen Myeloms unterstützen.

Kurkuma
Pixabay / stevepb
Eine Studie aus dem Jahr 2013 zeigte, dass Kurkuma beziehungsweise dessen Inhaltsstoff Curcumin gemeinsam mit Wirkstoffen aus Thalidomid die bösartigen Zellen eines Plasmozytoms angreifen und töten kann. Moleküle aus dem ursprünglichen Übelkeitsbekämpfer Thalidomid verstärken die Wirksamkeit des Kurkumas.
Seitdem arbeiten Forscher daran, beide Stoffe zusammenzubringen, um einen Stoff zu entwickeln, der die Tumoren wirksam bekämpfen kann. Dabei hat die Kombination aus beiden Inhaltsstoffen keinen schädlichen Effekt auf den Körper des Patienten.
Dem gelben Farbstoff, dem Curcumin, werden verschiedene krebs- und entzündungshemmende Eigenschaften nachgesagt. Aus diesem Grund gilt Kurkuma nicht nur als äußerst gesund, sondern kann Tumorpatienten auch dabei helfen, den Krebs wirksam zu bekämpfen.
Kardobenedikte
Die auch als Benediktenkraut oder Bitterdistel bekannte Heilpflanze soll nicht nur gegen Magen–Darm-Beschwerden, Fieber, Gicht und Schlaflosigkeit helfen, sondern auch bei der Behandlung verschiedener Krebserkrankung eine positive Wirkung zeigen. Dazu gehören unter anderem Brustkrebs, aber auch Plasmozytome.
Ätherische Öle
Bislang ist nicht bekannt, ob und wenn ja, welche, ätherischen Öle eine Wirkung gegen Plasmozytome haben.
Homöopathie & Globuli
kann bei er Erkrankung an einem Plasmozytom vor allem zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität beitragen. Eine Stärkung des Immunsystems ist der Schlüssel, um die Erkrankung effektiv zu bekämpfen. Hierzu kann Homöpathie einen Anstoß leisten.
Zudem hilft sie bei der Verbesserung des subjektiven Befindens. Dies wiederum hilft dem Körper des Patienten dabei, sich ganz der Bekämpfung der Erkrankung zu widmen. Hinzu kommt eine Linderung der Schmerzen und die womögliche Bekämpfung von Sekundärerkrankungen. Nebenwirkungen der Chemotherapie können gelindert werden.
Um diesen Effekt zu erreichen, kann die Einnahme der folgenden Mittel sinnvoll sein:
- Nux vomica
- Avena sativa
- Kalium phosphoricum
- Phosphor
Insbesondere die Einnahme von Phosphor kann bei der Erkrankung an einem Multiplen Myelom hilfreich sein. Es bekämpft nicht nur die Angst und Ermüdung, sondern gleichzeitig auch die Blutanämie, die die Krankheit auslöst. Gegen Knochenschmerzen kann unter anderem Mercurius solubilis eingenommen werden. Um die Anspannung vor Untersuchungen zu lindern, ist Gelsemium ein weiterer möglicher Hilfsbaustein.
Schüssler-Salze
Schüssler-Salze gegen Nebenwirkungen der Chemotherapie
Ähnlich wie Globuli können auch Schüssler-Salze zur begleitenden Krebstherapie eingesetzt werden. Bei Plasmozytomen eignet sich beispielsweise das Schüssler-Salz Nr. 3 (Ferrum phosphoricum) dazu, die Nebenwirkungen einer Chemotherapie gering zu halten. Zudem bekämpft es die Anämie und kann helfen, die Erschöpfungszustände in den Griff zu bekommen.
 Da es im Rahmen einer Chemotherapie zudem häufig zu Beschwerden im Bereich des Magens und Darms kommen kann, kann das Schüssler-Salz Nr. 13 (Kalium arsenicosum) unterstützend eingesetzt werden, um diese Probleme zu regulieren. Selenium, das Schüssler-Salz Nr. 26, ist ein Mittel zum Schutz der Zellen und schützt so auch gegen krebserregende Stoffe.
Da es im Rahmen einer Chemotherapie zudem häufig zu Beschwerden im Bereich des Magens und Darms kommen kann, kann das Schüssler-Salz Nr. 13 (Kalium arsenicosum) unterstützend eingesetzt werden, um diese Probleme zu regulieren. Selenium, das Schüssler-Salz Nr. 26, ist ein Mittel zum Schutz der Zellen und schützt so auch gegen krebserregende Stoffe.
Schüssler-Salze für mentale Stärke
Verschiedene Schüssler-Salze tragen zu innerem Wohlbefinden bei. Bei Krebserkrankungen werden besonders die nachfolgenden Salze empfohlen, um die Psyche zu stärken und dem Patienten das Gefühl zu geben, gegen die Krankheit ankommen zu können.
Geeignet sind die Schüssler-Salze Nr.:
Diät & Ernährung
Zunächst ist in Bezug auf die Ernährung bei einem Plasmozytom festzuhalten, dass es „die Krebsdiät“ nicht gibt. Über die Ernährung kann die Erkrankung nicht geheilt werden.
Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die Erkrankte rund ums Thema Ernährung beachten sollten. Bei Multiplen Myelomen und anderen Tumorarten, die das Immunsystem schwächen, ist es beispielsweise wichtig, beim Kochen besonders auf Hygiene zu achten.
Hygiene und Vorsichtsmaßnahmen
Betroffene sollten immer penibel auf die Sauberkeit von Schneidebrettern, Lappen und des Kühlschrankes achten. Keime und Bakterien greifen das Immunsystem zusätzlich an und schwächen die Immunabwehr.
Was gesunde Menschen problemlos verkraften, kann bei Tumorerkrankten zu Problemen führen. Von Komposthaufen und Biotonnen sollten Menschen mit Plasmozytomen sich zudem fernhalten, um Pilzinfektionen und Bakterien zu entgehen.
Fisch und Fleisch
Auf rohes Fleisch und rohen Fisch sollten Erkrankte verzichten, um das Immunsystem nicht zusätzlich zu belasten. Aus diesem Grund ist Fleisch vor dem Verzehr immer gut durchzubraten. Wer das nicht tut, riskiert beispielsweise Salmonellen. Ähnlich sieht es bei Fisch aus. Ab einer gewissen Temperatur werden Bakterien und Viren abgetötet und die Gefahr, zusätzlich zu erkranken, wird gesenkt.
Flüssigkeitsaufnahme als goldene Regel
Besondere Diäten sind bei der Erkrankung mit einem Plasmozytom nicht einzuhalten. Allerdings ist die Nierenfunktion durch die Tumoren stark eingeschränkt. Um den Körper zu unterstützen, wird daher eine hohe Flüssigkeitsaufnahme angeraten.
Bestenfalls sollten Betroffene mehrere Liter Wasser am Tag trinken, um die Nierenfunktion zu unterstützen. Ansonsten wird je nach Einzelfall der behandelnde Arzt mit dem Patienten besprechen, welche Ernährungsmaßnahmen anzuraten sind.
FAQ – Fragen & Antworten
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Plasmozytom.
Woran merken Betroffene, dass sie erkrankt sind?
Ein Plasmozytom äußert sich unterschiedlich und die Symptome sind unspezifisch. Die meisten Patienten klagen über Knochen- und insbesondere Rückenschmerzen. Zudem kommt es zu Müdigkeit und Abgeschlagenheit sowie einer Anämie, die diese Symptome mitauslöst.
Plasmozytompatienten klagen außerdem über eine erhöhte Körpertemperatur und Nachtschweiß. Beschwerden der Nieren können genauso auftreten wie spontane Knochenbrüche. Da die Erkrankung das Immunsystem schwächt, sind häufige Infektionskrankheiten keine Seltenheit.
Ist ein Plasmozytom heilbar?
Nein, die Erkrankung ist bislang nicht vollständig heilbar. Ausnahmen bilden Erkrankte, bei denen nur eine Stelle befallen ist und die jung genug sind, eine allogene Knochenmarktransplantation zu verkraften.
Allerdings kann bei einem guten Verlauf auch bei Patienten, die gut auf die Behandlungen ansprechen, die Erkrankung zurückgedrängt werden. Das bedeutet, dass sie vorerst schläft und den Körper nicht weiter angreift. Die Prognosen hierzu sind jedoch sehr unterschiedlich. Das Hauptziel der Therapie ist es, die Lebensqualität zu erhöhen und zu erhalten.
Wie häufig ist das Plasmozytom und wer ist betroffen?
Zwar handelt es sich bei dem Plasmozytom um die zweithäufigste Tumorerkrankung des Knochenmarks, allerdings ist sie selbst innerhalb der Krebserkrankungen eher selten. Nur ein Prozent der festgestellten Tumoren sind Multiple Myelome. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, an einem Plasmozytom zu erkranken. Der Höhepunkt liegt über dem 60. Lebensjahr.
Ist die Krankheit vererbbar oder ansteckend?
Es ist nicht genau geklärt, inwieweit Erbfaktoren bei der Erkrankung an einem Plasmozytom eine Rolle spielen. Allerdings scheint es durchaus interfamiliäre Häufungen zu geben. Trotzdem handelt es sich um keine Erbkrankheit im eigentlichen Sinne. Ansteckend ist das Plasmozytom hingegen nicht.
