
Pixabay / mcruetten
Klaustrophobie, eine spezifische Angststörung
Die Klaustrophobie, auch als Raumangst bezeichnet, ist eine spezifische Angststörung, die sich in der Angst vor geschlossenen bzw. engen Räumen oder einer Ansammlung von großen Menschenmengen äußert. Es spielt keine Rolle ob diese Angst auf ein tatsächliches Eingesperrt sein, auf eine reale Masse von Menschen bezogen ist oder sich diese bloß in der Vorstellung abspielt. Die Angst vor dem Kontrollverlust steht dabei im Vordergrund.
Die Klaustrophobie ist abzugrenzen von der Agoraphobie, die als Platzangst oder Platzfurcht bezeichnet wird und sich i.d.R. auf weite Plätze bezieht. Klaustrophobie und Agoraphobie können jedoch auch zusammen auftreten.
Steckbrief: Klaustrophobie
Inhaltsverzeichnis
- 1 Steckbrief: Klaustrophobie
- 2 Definition Klaustrophobie
- 3 Was ist die Raumangst?
- 4 Ursachen & Faktoren
- 5 Symptome & Anzeichen
- 6 Diagnose & Untersuchung
- 7 Häufigkeit & Diagnosedaten
- 8 Komplikationen & Folgen
- 9 Wann zum Arzt?
- 10 Behandlung & Therapie
- 11 Vorbeugung & Prävention
- 12 Prognose zur Heilung
- 13 Klaustrophobie & Neurologie
- 14 Alternative Medizin
- 15 FAQ – Fragen & Antworten
- Name(n): Klaustrophobie / Raumangst
- Art der Krankheit: Psychologische Erkrankung
- Verbreitung: Weltweit
- Erste Erwähnung der Krankheit: 1879
- Behandelbar: Gut
- Art des Auslösers: Diverse
- Wieviele Erkrankte: Ca. 7-8% der Weltbevölkerung
- Welchen Facharzt sollte man aufsuchen: Psychologe – Psychiater – Psychotherapeut – Verhaltenstherapeut
- ICD-10 Code(s): f40.2
Table of Contents
Definition Klaustrophobie
Die Klaustrophobie gehört gemäß der internationalen Klassifikation von Diagnosen (ICD10) zu den phobischen Störungen (F40.) und wird dem ICD10-Code f40.2 zugeordnet.
Ein genauerer Blick auf den philologischen Ursprung der Klaustrophobie verdeutlicht den Unterschied zur oftmals synonym gebrauchten Platzangst (Agoraphobie). Der Begriff Klaustrophobie spaltet sich in zwei Teile.
Der lateinische Begriff claustrum bedeutet Verschluss, Schloss, Riegel oder auch Sperre, Käfig, enger Durchgang. Der altgriechische Begriff Phobie wird mit Furcht übersetzt.
Die Angst, die aus der Klaustrophobie entspringt, ist unverhältnismäßig, so dass sich in der Folge auf angstauslösende Faktoren fokussiert wird und der Betroffene nicht in der Lage ist, die auslösende Situation realistisch einzuschätzen.
Als spezifische Phobie wird die Angst somit auf einen spezifischen Auslöser, ein gezieltes Objekt gerichtet, in diesem Fall enge Räume oder viele Menschen, die eine große Enge verursachen. Eine generalisierte Angststörung ist im Gegensatz dazu nicht auf eine bestimmte Situation oder ein spezifisches Objekt gerichtet.
Was ist die Raumangst?
Die Klaustrophobie bezieht sich auf Orte, die nicht ohne weiteres verlassen werden können auf Grund von Enge oder einer großen Anzahl von Menschen, die Auswege versperren oder eine sofortige Flucht verhindern könnten. Bei Letzterem werden z.B. große Partys vermieden, auf denen sich viele Menschen aufhalten.
Public Viewing ist für Klaustrophobiker oft unmöglich. Die Vorstellung inmitten all der Menschen zu stehen, ohne die Möglichkeit zu haben, den Ort schnell verlassen zu können, löst bei vielen Betroffenen Angstzustände aus. Manche schaffen es, sich zumindest am Rande solcher Veranstaltungen aufzuhalten, um bei Bedarf sofort einen Fluchtweg zu haben.
Auch in engen Räumen fehlt oftmals die Möglichkeit, sich der Situation bei Bedarf sofort zu entziehen. Der Aufenthalt in Fahrstühlen, Tunneln, Flugzeugen, Bussen und Bahnen muss für einen gewissen Zeitraum ertragen werden. Auch das Einkaufen im Supermarkt kann schwierig sein. Insbesondere beim Anstehen an der Kasse reagieren viele Menschen mit Klaustrophobie. Es stehen Menschen vor ihnen, Menschen hinter ihnen, es herrscht eine große Enge und es gibt kaum Möglichkeiten sich zu bewegen.
Entstehung & Instinkt
In solchen Situationen werden Stresshormone ausgestoßen, da dem Körper eine Bedrohung suggeriert wird, die durch die Enge und schlechte Luft zustande kommt. Die Evolutionäre Reaktion auf eine solche Bedrohung wäre Flucht oder Kampf.
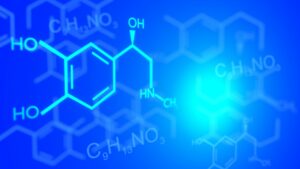
Adrenalin (Stresshormon)
Pixabay / ColiN00B
Beides ist im Kontext der Klaustrophobie in modernen Gesellschaften nicht möglich. Aus einem Urinstinkt heraus ist es also vollkommen normal, sich nur mit einem unsicheren Gefühl z.B. in engen Räumen ohne Fenster aufzuhalten, da der Mensch sich evolutionär immer einen Fluchtweg offenhalten möchte.
Hinzu kommt nicht selten die Angst davor wie andere Menschen reagieren könnten, wenn die Betroffenen sich ihre Angst anmerken lassen.
Auch wenn Klaustrophobiker wissen, dass ihnen nichts passieren kann bzw. tatsächliche Vorkommnisse prozentual nicht ins Gewicht fallen, helfen ihnen diese Fakten gegen ihre Phobie nicht weiter. Sie sind, sofern sie mit der angstauslösenden Situation bzw. dem angstauslösenden Objekt konfrontiert werden, nicht in der Lage, die Situation realistisch einzuschätzen.
Ursachen & Faktoren
Die Ursachen für die Entstehung einer Klaustrophobie können vielfältig sein und sind aus medizinisch-therapeutischer Sicht nicht immer klar zu fassen.
Es kristallisieren sich jedoch einige potentielle Faktoren heraus:
- Die genetische Veranlagung eines Menschen kann durchaus eine Rolle spielen. Wer allgemein eine zu Ängsten neigende Persönlichkeit ist, sich zurückzieht, nur selten mitteilt und sehr empfindsam ist, somit also zu Verletzlichkeit neigt, kann in manchen Fällen leichter eine Klaustrophobie entwickeln.
- Die Psychodynamik kann durchaus eine Ergänzung zum ersten Punkt sein. Die innerseelischen Kräfte, die Einflüsse auf den Einzelnen und seine Stimmung haben Konsequenzen auf Verhalten/Reaktion des Menschen. Die entwickelten Verhaltensmuster bestimmen darüber, inwieweit sich der Einzelne innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen abgrenzen kann. Defensive Persönlichkeiten können nur schwer eine Grenze ziehen, lassen sich im Zweifelsfall vereinnahmen und haben das Gefühl von unerträglicher Enge und Atemnot. Diese Unsicherheit wird sinnbildlich in Form der Klaustrophobie erlebt.
- Zum einen gibt es negative Erlebnisse in der Vergangenheit, in denen der Betroffene tatsächlich eingesperrt war oder bedrängt wurde und sich nicht befreien konnte. Zum anderen können ähnliche Erlebnisse anderer, insbesondere Nahestehender, lediglich durch Erzählungen solche Ängste im Zuhörer auslösen, so dass dieser selber mit einer Klaustrophobie reagiert.
- Die Angst eingesperrt zu werden, nicht mehr hinauszukönnen oder in einer großen Menschenmasse gleichsam gefangen zu sein, ist eine Urangst und kann ebenfalls zu dieser spezifischen Angststörung führen.
- Eine zufällige Entwicklung der Klaustrophobie stellt die Konditionierung, also die Erlernung dieser phobischen Reaktionen dar.
- Eine letzte Möglichkeit stellt die schleichende Entwicklung der Klaustrophobie dar, ohne dass sich ein wirklicher Auslöser finden lässt.
Symptome & Anzeichen
und Anzeichen zeigen sich sich bei Betroffenen nicht nur in den diesbezüglichen angstbesetzten Situationen, sondern können allein schon bei dem Gedanken oder der Erinnerung an die entsprechenden Situationen auftreten.
 Die Klaustrophobie macht es oftmals schwer, die Symptome und Anzeichen vor anderen zu verstecken, da sie nicht selten in der Öffentlichkeit auftreten. Der Besuch von überfüllten Geschäften (z.B. zur Weihnachtszeit) kann mit den Massen an Menschen schwierig sein. Sie überwältigen den Betroffenen psychisch und lassen ihm kaum Bewegungsfreiheit.
Die Klaustrophobie macht es oftmals schwer, die Symptome und Anzeichen vor anderen zu verstecken, da sie nicht selten in der Öffentlichkeit auftreten. Der Besuch von überfüllten Geschäften (z.B. zur Weihnachtszeit) kann mit den Massen an Menschen schwierig sein. Sie überwältigen den Betroffenen psychisch und lassen ihm kaum Bewegungsfreiheit.
Das Betreten eines Fahrstuhls, ein zeitweise verschlossener Raum, in dem sich ggf. noch andere Menschen befinden, ist eine Herausforderung. Der Fahrstuhl bietet keinen Ausweg, keinen Notausgang. Die Entscheidung, die Situation zu beenden, ist nicht mehr vom eigenen Willen abhängig.
Die Angst überfällt den Betroffenen oft mit erheblichen körperlichen Symptomen, die sich derart intensiv zeigen können, dass die Menschen das Gefühl haben, zu sterben. Wer diese Anzeichen das erste Mal erlebt und sie nicht mit einer Phobie in Einklang bringen kann, erlebt zusätzliche Ängste, dass eine physische Erkrankung den Körper befallen haben könnte.
Wer seine Angst kennt und gelernt hat, die entsprechenden Symptome zu erkennen, ist sich der Symptome bewusst, leidet im schlimmsten Fall dennoch ein Leben lang unter ihnen.
Die unten erwähnten Symptome können in einigen Fällen vor anderen mehr oder weniger gut versteckt werden, manchmal werden sie jedoch für jeden offensichtlich.
Klaustrophobie Symptome und Anzeichen:
- Angstzustände
- Panikattacken
- Schweißausbrüche
- Engegefühl in der Brust
- Herzklopfen bis hin zu Herzrasen
- Atemprobleme bis hin zu Atemnot
- Zittern
- Schwindelgfühle
- Übelkeit
- Ohnmachtsgefühle
- Harndrang
- Stuhlgang bis hin zu Durchfall
Diagnose & Untersuchung
Die Diagnose beginnt in der Regel mit dem Besuch beim Hausarzt, wo man die Symptome gemeinsam besprechen kann. Durch ein intensives Gespräch mit einem Allgemeinmediziner des Vertrauens kann der erste Verdacht auf eine Klaustrophobie erhärtet werden.
Der Betroffene kann dann zu einem Therapeuten überwiesen werden, der sich mit dieser Art der Phobie auskennt. Dabei werden genaue Fragen gestellt, die sich auf den Beginn der Beschwerden beziehen, die Dauer der phobischen Reaktion und die Stärke der Symptome, ob die Angst auf spezifische Situationen (z.B. Fahrten mit dem Zug) bezogen ist oder sich auf bestimmte Objekte richtet.

Magnetresonanztomograph (MRT)
Dabei versucht der Therapeut zu eruieren, ob weitere psychische Erkrankungen vorliegen könnten, z.B. eine Depression, da eine einseitige Behandlung ansonsten kaum Wirkung erzielen würde. Im diagnostischen Verlauf können jedoch weitere Untersuchungen folgen, um andere Angst-Auslöser auszuschließen.
- Eine Schilddrüsenüberfunktion kann ebenfalls eine Klaustrophobie auslösen. Dies kann mit einer Ultraschall-Untersuchung der Schilddrüse geklärt werden.
- Laborwerte können Auffälligkeiten im Blut aufzeigen und somit z.B. organische Probleme attestieren, die zu einer Klaustrophobie führen können.
- Das EKG (Elektrokardiogramm) misst die elektrischen Spannungsänderungen am Herzen. Auch hier können Gründe für eine Klaustrophobie liegen.
- Die MRT (Magnetresonanztomographie) kann Krankheitsauslöser im Gehirn erfassen.
Krankheitsverlauf
Der Verlauf einer Klaustrophobie kann unterschiedlich sein. Je nach angstauslösender Situation bzw. angstauslösendem Objekt können die Anlässe gemieden werden, ohne dass der Alltag des Betroffenen wesentlich gestört wird.
Nicht jeder Mensch ist auf die Benutzung eines Busses angewiesen, so dass hier ein Vermeidungsverhalten keinerlei oder zumindest kaum negative Konsequenzen nach sich zieht. Dabei wird die Angst jedoch nicht behandelt, sondern ihr wird lediglich aus dem Weg gegangen.
In anderen Situationen kann die Lebensqualität unter solchen Umständen erheblich gesenkt werden und das Sozialleben nimmt erheblichen Schaden. Hier führt die Vermeidungsstrategie zu noch mehr Angst, diese wiederum verstärkt das Vermeiden und intensiviert die Angst wiederum. Es entsteht ein Teufelskreis.
Der Griff zu angstlösenden Medikamenten, die jedoch schnell zu Abhängigkeit führen können ebenso wie Alkohol, ist immer wieder zu beobachten.
Bei manchen Betroffenen klingen Phobien von selber wieder ab, manch andere geraten immer tiefer in Die Spirale hinein. Als Faustregel gilt jedoch: Je früher man sich Hilfe sucht, umso größer sind die Erfolgsaussichten, die Klaustrophobie effektiv zu bekämpfen.
Häufigkeit & Diagnosedaten
Die Daten zu Häufigkeit und Diagnosedaten bei Klaustrophobie sind wie bei vielen psychischen Erkrankungen nicht immer leicht herauszufinden und variieren dementsprechend. Dies hängt auch damit zusammen, ab wann man von einer phobischen Auffälligkeit oder einer tatsächlichen Pathologie sprechen kann und inwieweit sie von anderen psychischen Erkrankungen abgegrenzt wird. Hier gehen die Meinungen je nach Studie auseinander.
Interessante Daten liefern die Untersuchungen in einem geschlossenen Magnetresonanztomographen (MRT). Hier gibt es immer wieder Patienten, die die Enge im MRT kaum aushalten, zu Angst- und Panikreaktionen neigen und die Untersuchung abbrechen.
Murphy und Brunberg (siehe ihre Veröffentlichung Adult claustrophobia, anxiety and sedation in MRI) haben dazu 1997 eine Studie veröffentlicht. Sie beobachteten in einem Zeitraum von sieben Wochen 939 Patienten ab dem 18. Lebensjahr in einem MRT.
Während dieser Untersuchung war es vonnöten, dass die Patienten maximal 40 Minuten in einem geschlossenen MRT ruhig liegen bleiben mussten, um die benötigte Bildqualität zu gewährleisten.
14,3%, also 134 Personen, brauchten eine orale oder intravenöse Sedierung bzw. eine Allgemein-Anästhesie, um die Untersuchung durchführen lassen zu können, da sie auf Grund von massiven klaustrophobischen Reaktionen ohne Beruhigungsmittel nicht in der Lage waren, die MRT-Untersuchung über sich ergehen zu lassen.
Von diesen 134 Personen waren 35,8% männlich und 64,1% weiblich. Frauen brauchten häufiger eine Sedierung als Männer ebenso wie Patienten mit Untersuchungen des Schädelbereichs. Patienten, die die MRT-Prozedur schon einmal erfahren hatten, brauchten prozentual häufiger eine Sedierung als Patienten, die die Untersuchung das erste Mal erlebten.
Komplikationen & Folgen
Komplikationen bei der Klaustrophobie sind letztlich nicht vielfältig, aber können einschränkend für das eigene Leben sein.
Vermeidungsverhalten
Vermeidungsverhalten bestimmter Situationen kann in die soziale Isolation führen. Wer sich nicht auf größere Veranstaltungen mit seinen Freunden traut, sozialen Kontakten mit einem hohen Aufkommen von Menschen aus dem Weg geht und sei es nur der Besuch im nächstgelegenen Restaurant, kapselt sich ab, wenn er stattdessen alleine zu Hause sitzt.
Auch die eigene Wohnung kann durch das Überladen durch zu viele Besucher auf einmal zu einem unsicheren Ort werden, der keinerlei Schutz mehr bietet. Es entsteht das Gefühl der Enge, der Ausweglosigkeit und somit des Machtverlustes über den eigenen Wohnraum.
Der Supermarkt kann ebenfalls als potentielle Gefahrenquelle angesehen werden. Ein großer Raum, oftmals ohne Fenster, wenig Ein- und Ausgänge mit einer Vielzahl von Menschen überfordert die Betroffenen oftmals.
Das Anstehen an der Kasse kann das Gefühl des Gefangenseins suggerieren. Menschen stehen vor einem, Menschen stehen hinter einem und die Vorwärtsbewegung lässt sich kaum durch das eigene Handeln beeinflussen.
Der Einkauf wird so zur Tortur, die im schlimmsten Falle darin endet, dass der Einkauf von Lebensmitteln vermieden wird. Das Ergebnis sind leere Schränke und ohne Hilfe droht der Hunger.
 Destruktive Selbsthilfemaßnahmen
Destruktive Selbsthilfemaßnahmen
Eine weitere Komplikation stellen destruktive Selbsthilfemaßnahmen dar. Der Einsatz von legalen oder illegalen Drogen, um seine Angst nicht mehr spüren zu müssen, kann neben der Klaustrophobie zu einer Suchtproblematik führen.
Der Gebrauch von Alkohol, um sich aufzulockern, kann schnell zu Missbrauch und Abhängigkeit führen. Auch der Genuss von Cannabis oder härteren Drogen kann Ängste und Panikreaktionen jeglicher Art hervorrufen, ganz zu schweigen von Depressionen, drogeninduzierten Psychosen und bei übermäßigem Missbrauch zu schweren Konzentrationsstörungen führen.
Wann zum Arzt?
Wann sollte man zum Arzt gehen?
Auch wenn der Alltag und das Sozialleben noch nicht eingeschränkt sind, sollte man sich bewusst machen, dass eine Verschlimmerung der Symptome schnell voranschreiten kann. Der Besuch beim Hausarzt mit einem klärenden Gespräch und ggf. anschließenden körperlichen Untersuchungen kann das Vorliegen einer Klaustrophobie bestätigen.
Spätestens dann sollte therapeutische Hilfe in Anspruch genommen werden. Nach intensiver Rücksprache mit dem behandelnden Arzt kann ebenfalls eine Unterstützung durch einen ambulanten Psychiater erfolgen, der leichte angstlösende Medikamente in Form von Antidepressiva verschreibt, die nicht abhängig machen.
Behandlung & Therapie
Es gibt unterschiedliche Behandlungs- und Therapiemethoden, die bei Klaustrophobie äußerst effektiv wirken können und den Betroffenen das Handwerkszeug an die Hand geben, um mit den Symptomen besser umgehen zu können und im besten Fall völlig beschwerdefrei zu werden.
Es ist jedoch gut, sich als Betroffener mit den unterschiedlichen therapeutischen Methoden auseinanderzusetzen und die für sich geeignete herauszufinden. In diesem Sinne ist auch eine positive, von Vertrauen geprägte Beziehung zum Therapeuten eine notwendige Voraussetzung, um konstruktiv arbeiten zu können.
Konfrontationstherapie
Die Konfrontationstherapie (Exposition) setzt den Klienten den angstauslösenden Situationen bzw. Objekten aus und konfrontiert ihn damit. Der Verhaltenstherapeut wirkt dabei unterstützend und hilft dem Klienten in direkter Weise, mit angstauslösenden Reizen umzugehen.
Dabei ist die reale Einschätzung von großer Bedeutung, da sie den Lernprozess in Gang setzt, dass die Situationen und Objekte, die die Klaustrophobie auslösen, keine Gefahr darstellen. Hat der Betroffene z.B. Angst vor Zugfahrten kann man sich diesem Thema langsam annähern.
Ein Bestandteil besteht schließlich darin, mit therapeutischer Unterstützung die ersten Zugfahrten gemeinsam zu unternehmen bis der Klient im Idealfall diese Unternehmung alleine und ohne Probleme meistern kann.
Kognitive Verhaltenstherapie

Die Klaustrophobie Behandlung kann mittels kognitiver Verhaltenstherapie erfolgen
Die kognitive Verhaltenstherapie eignet sich dafür, einen Blick auf die destruktiven Einstellungen, Denkgewohnheiten und Überzeugungen bezüglich der Klaustrophobie zu werfen, um gegen die Auslöser und Symptome angehen zu können.
Dabei wird die Art und Weise, wie der Patient über sich selber denkt auch und gerade im Kontext anderer Menschen bearbeitet, Auch die Reaktionen auf Ereignisse spielen dabei eine Rolle. Häufig gehen Realität und eigene Erwartungen auseinander und führen zu Problemen mit sich selbst und der Umwelt.
Wer von sich selber einen andauernden Perfektionismus verlangt, in unbeweglichen Verhaltensmustern gefangen ist, die keine Alternativen erlauben oder sich falschen Vorannahmen hingibt, entwickelt Denkmuster, die mit der Zeit zu pathologischen Reaktionen, wie der Klaustrophobie führen können. Therapeut und Patient versuchen gemeinsam, diese Denkmuster aufzuspüren und entsprechend zu durchbrechen.
Weitere Therapien
Für manchen Betroffen kann auch eine psychoanalytische Therapie von Nutzen sein. Hier geht man davon aus, dass problematisches Verhalten im Erwachsenenalter aus ungelösten und verborgenen Konflikten oder Traumata aus der Kindheit herrührt.
Der begleitende Einsatz von Psychopharmaka in Verbindung mit einer Verhaltens- oder Psychotherapie kann ebenfalls hilfreich sein. Der klassische Ansatz bezieht sich auf die Behandlung mit Antidepressiva.
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) oder trizyklische Antidepressiva können hilfreich sein und bergen nicht die Gefahr, abhängig zu machen. In Notfällen kann auch der kurzfristige Einsatz von Benzodiazepinen wie Diazepam (Valium) u.a. hilfreich sein. Diese Mittel haben jedoch ein hohes Suchtpotential.
Vorbeugung & Prävention
Der Klaustrophobie lässt sich wie auch bei anderen Ängsten bedingt vorbeugen. Man sollte sich über seine eigenen Unsicherheiten und Ängste bewusst sein und sie ggf. mit der Vernunft betrachten.

Pixabay / StockSnap
In diesem Falle ist es vonnöten, Situationen und Objekte, die mit Angst behaftet sind und in Richtung Klaustrophobie weisen, absichtlich entgegenzutreten und sich den Ängsten zu stellen. Je öfter der Betroffene dies durchführt, um so häufiger wird er merken, dass er keinen Schaden erleidet.
Es mag hier und da unangenehme Situationen geben. Ein Fahrstuhl kann mal für wenige Sekunden stecken bleiben. Flugzeuge stürzen ab und Zugkatastrophen geschehen ebenso. In der Europäischen Union gibt es in beiden Situationen jedoch lediglich 0,035 Tote pro 100 Millionen Personenkilometer (beim Auto sind es 0,7 Tote pro 100 Millionen Personenkilometer.)
Diese Situationen sind also selten und kein Grund, sich derart einengen zu lassen, dass die Klaustrophobie das eigene Leben und den Alltag diktiert. Das eigene Leben ist in diesen Situationen i.d.R. nicht in Gefahr.
Dennoch lässt sich nicht alles mit der Vernunft betrachten und der Mensch ist ebenso Seele und evolutionär gewachsen, d.h. mit Urängsten behaftet.
Prognose zur Heilung
Die Prognose zur Heilung einer Klaustrophobie ist in den meisten Fällen positiv, insbesondere wenn rechtzeitig therapeutische Hilfe in Anspruch genommen wird. Je früher ein Therapeut aufgesucht wird, umso schneller und effektiver kann geholfen werden, da sich die angstauslösenden Muster im Gehirn noch nicht so stark verfestigt haben und somit das Denken und Fühlen permanent überwältigen.
Die Heilungschancen liegen schon nach den ersten Sitzungen bei ca. 80%. Dabei gibt es unterschiedliche Therapieansätze, die dem Betroffenen zur Auswahl stehen und unter denen er die für sich geeignete heraussuchen sollte.
Die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema außerhalb des therapeutischen Settings kann jedoch die Heilungschancen noch einmal verbessern. Wer seine eigene Erkrankung kennt und sich auf einer fachlichen Ebene mit dem Thema beschäftigt, kann die Zusammenhänge, die sehr persönlicher Natur sein können, besser einschätzen und wird gleichsam zum Fachmann bzw. zur Fachfrau für die Klaustrophobie.
Schwere Fälle von Klaustrophobie, die erst vergleichsweise spät behandelt werden, haben es deutlich schwerer. In seltenen Fällen reicht eine ambulante Therapie nicht aus und es sollte eine tagesklinische oder stationäre Behandlung erwogen werden.
Klaustrophobie & Neurologie
Die Neurologie hat in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht, um Prädispositionen für bestimmte Erkrankungen nachzuweisen. Die Klaustrophobie bildet hierbei keine Ausnahme.
Um die Bedeutung dieser Erkenntnis für das menschliche Verhalten einschätzen zu können, untersuchten die Forscher die DNS-Sequenz des menschlichen Gpm6a Gens an 115 Klaustrophobikern und Kontrollpersonen.
Offensichtlich wies das Gpm6a Gen bei den Klaustrophobikern Veränderungen auf, so dass von einer individuellen genetischen Veränderung auszugehen war. Es schien, dass ein einziges Gen für die Regulierung der Klaustrophobie verantwortlich war.
Wäre es möglich, dieses Gen zu manipulieren, ließe sich ggf. eine gesunde Art und Weise finden, um mit spezifischen Stressauslösern umzugehen.
Alternative Medizin
Alternative Behandlungsmethoden gegen Klaustrophobie
Klaustrophobie und die immer wiederkehrende körperliche Anstrengung können belastend für Geist, Psyche und Körper sein. Alternative Behandlungsmethoden können unterstützend wirken, um in Verbindung mit einer Psychotherapie zumindest ein Maß an körperlicher und somit auch seelischer Entspannung zu erreichen.
- Die Progressive Muskelentspannung (PME) nach Jacobson ist eine Methode zur Entspannung, bei der bestimmte Muskelgruppen abwechselnd angespannt und entspannt werden. Dies soll einer gleichzeitigen Verbesserung der Wahrnehmung des Körpers dienen.
- Das autogene Training (AT) ist ebenfalls eine Form zur Entspannung, die jedoch von innen heraus kommt. Ziel ist es, die Muskeln zu entspannen und dem Gehirn zu suggerieren, dass eine Art der Gelassenheit herrscht, die sich auf das Innere übertragen soll.
- Selbsthilfegruppen sind für Klaustrophobiker eine gute Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zusammen zu treffen und ohne Scham über ihre Probleme zu sprechen. Im idealen Fall können sich die Mitglieder einer Gruppe sowohl emotional als auch aktiv gegenseitig unterstützen und in der Gemeinschaft gegen ihre Ängste angehen.
- Akupunktur: Die Akupunktur kann, angewandt durch einen Nadelstich u.a. in der Handgelenksbeugefalte, auch gegen Klaustrophobie eingesetzt werden.
- Massagen können sinnvoll ergänzend zu einer Therapie gegen Klaustrophobie eingesetzt werden. Da die psychische Belastung bei Angstzuständen auch den Körper ergreift und zu massiven und schmerzhaften, oftmals chronischen Verspannungen führt, kann eine Massagetherapie die körperlichen Spannungen auflösen und zugleich ein seelisches Wohlgefühl vermitteln.
- Meditation kann helfen, das seelische Gleichgewicht zu verbessern und einen inneren konstruktiven Fokus zu finden.
Es gibt jedoch noch andere Hilfsmittel, die helfen können, die Klaustrophobie besser zu kontrollieren. Dazu gehören Mittel zur Selbsthilfe, aber auch Unterstützung von außen, z.B. in Form von körpertherapeutischen Maßnahmen, die insbesondere der Muskulatur durch die immer wiederkehrende Anspannung Linderung verschafft und somit auch auf die Seele positiv einwirkt.
EMDR

Pixabay / Free-Photos
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Das EMDR-Verfahren in Punkt 1 bildet eine Ausnahme, die Punkte 2 bis 6 hingegen können unterstützend bei psychotherapeutischen Maßnahmen ergänzend wirken.
Durch die EMDR-Technik, bei der die Augen in einem bestimmten Rhythmus hin- und herbewegt werden, versucht man bei der Klaustrophobie, die Verbindung zwischen einer als unangenehm oder bedrohlich erlebten Situation und dem daraus resultierenden geistigen bzw. körperlichen Gefühl aufzuheben. EMDR ist keine ergänzende Maßnahme zu einer Psychotherapie, sondern ist als eigenständige Therapiemethode zu betrachten.
Klaustrophobie Hausmittel
Hilfreiche Hausmittel gegen Raumangst
- Bei akuten Angstzuständen kann ein heißes Bad helfen. Der Zusatz von Duftölen kann die beruhigende Wirkung verstärken.
- Angstanfälle können auch durch die Atmung reguliert werden. Wenn es möglich ist, sollte sich der Betroffene hinsetzen, die Hand auf den Bauch legen, den Atem einige Sekunden anhalten und dann in Ruhe ausatmen. Einige Atemzüge später sollte sich der Zustand gebessert haben. Solch eine Übung kann jedoch durchaus auch im Stehen, z.B. im Fahrstuhl praktiziert werden. Da bei Erregungszuständen die Atmung stark beeinflusst wird, sind Atemübungen in Stresssituationen prinzipiell eine gute Wahl.
- Positives Denken kann die Anzahl von Angstzuständen und Panikattacken mindern.
- 5-Hydroxytryptophan ist als Vorstufe von Serotonin in Form eines Nahrungsergänzungsmittels hilfreich gegen Angstzustände.
- Sport, insbesondere Ausdauersport, setzt Endorphine frei und führt zu Glücksgefühlen. Wer tiefes Glück empfindet, hebt sein Selbstbewusstsein und wird eine Linderung der Angst verspüren. Der Begriff Endorphin ist eine Zusammensetzung der Worte endogen und Morphin, so dass der Körper in der Lage ist, ein Opioid selbständig herzustellen. Körpereigene Opioide können bei Stressreaktionen Schmerzen unterdrücken. Es ist verständlich, dass der Mensch in einer solchen Situation den Fokus weitaus weniger auf Stress– bzw. Angstauslöser legt und sich leichter in seiner Umwelt bewegen kann.
- Vitamin B mindert Stress. Zudem braucht der Körper Vitamin B6, um Serotonin zu produzieren. Zu wenig Vitamin B kann Angstzustände auslösen oder diese sogar intensivieren. Vitamin-B-Komplexe lassen sich in Form von Kapseln in diversen Drogerien erstehen.
- Koffein und Alkohol sollten für Betroffene von Klaustrophobie und anderen Angsterkrankungen tabu sein. Die Ängste können sich vermehren. Insbesondere nach einem Rauschzustand durch Alkohol kann durch den emotionalen Fall die Klaustrophobie schlimmer als im Normalfall wiederkehren.
Heilkräuter & Heilpflanzen
Es gibt einige Kräuter, die sich gegen Angstzustände und Phobien, somit auch gegen die Klaustrophobie einsetzen lassen. Die Kombination von Kräutern, die eine beruhigende Wirkung haben, mit vom Arzt verschriebenen Beruhigungsmitteln, sollte jedoch zuvor mit einem Mediziner abgeklärt werden. Zudem kann eine zu große Menge an Kräutern, Ängste auch verstärken, so dass Umsicht geboten ist.
- Kamillentee kann unterstützend bei Nervosität wirken, da es Inhaltsstoffe in der Kamillenblüte gibt, die sich an die gleichen Gehirnrezeptoren anheften wie Valium. Kamille wirkt jedoch besser bei generalisierten Angststörungen.
- Bei Angststörungen jeglicher Art kann das in grünem Tee enthaltene L-Theanin helfen. Da Klaustrophobiker mit massiven körperliche Symptomen zu kämpfen haben, kann ihnen das L-Theanin helfen, den Blutdruck und die Herzfrequenz zu senken. Die Angstzustände werden allgemein weniger.
- Das aus Hopfen gewonnene Öl kann gegen Spannungszustände helfen. Das im Bier enthaltene Hopfen bringt jedoch keinen Nutzen.
- Angststörungen, so auch die Klaustrophobie, können zu permanenten Sorgen führen, die Schlafprobleme nach sich ziehen. Baldrian kann durch die beruhigenden Inhaltsstoffe schlaffördernd wirken. Als Kapseln sind sie oftmals bekannt, es gibt Baldrian jedoch auch als Flüssigkeit zum Einreiben.
- Zitronenmelisse kann gegen Schlaflosigkeit, Stress und Ängste helfen und fördert im Idealfall die Konzentration.
- Die Passionsblume ist äußerst effektiv bei Angststörungen und hilft gegen die oftmals nervösen Spannungen, denen Betroffene von Klaustrophobie in angstbesetzten Situationen ausgesetzt sind. Auch bei Schlafstörungen kann sie unterstützend wirken, sollte jedoch nur einen Monat eingenommen werden.
- Der Duft von Lavendel kann bei Nervosität helfen und die Krankheitszeichen von Angststörungen mindern. Die Wirkung ist ähnlich wie bei Lorazepam, ein Benzodiazepin, das ähnlich wie Valium wirkt. Lavendel gibt es zum einen als Kissen, so dass sich der Duft einatmen lässt oder als Lavendelölkapseln zur oralen Einnahme.
Ätherische Öle
Der ursprünglichste Sinn beim Menschen ist der Geruchssinn. In diesem Sinne bietet es sich an, bei Klaustrophobie mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Insbesondere bei einer flachen Atmung, die bei Angst- und Panikzuständen zu Atemnot führen kann, kann die Einatmung des Duftes ätherischer Öle durch die Nase die Atmung stabilisieren und das autonome Nervensystem reagiert somit positiv.
 Auch Neurotransmitter (biochemische Botenstoffe) werden vermehrt ausgeschüttet und verändern die Stimmung zum Positiven. Ein kleines Duftfläschchen kann zumeist ohne Probleme mitgeführt werden, wenn man unterwegs ist. Ansonsten kann man den Duft der Öle über Duftlampen oder Duftbrunnen verströmen lassen.
Auch Neurotransmitter (biochemische Botenstoffe) werden vermehrt ausgeschüttet und verändern die Stimmung zum Positiven. Ein kleines Duftfläschchen kann zumeist ohne Probleme mitgeführt werden, wenn man unterwegs ist. Ansonsten kann man den Duft der Öle über Duftlampen oder Duftbrunnen verströmen lassen.
Es eignen sich Räucherstäbchen oder man arbeitet sie in Pflegeprodukte für die Haut ein. Sollen die ätherischen Öle als Badezusatz dienen, mischt man diese mit ein paar Esslöffeln Sahne, einigen Esslöffeln Pflanzenöl und einem Teelöffel Honig mit fünf bis 10 Tropfen eines ätherischen Öls.
Bei einer Wassertemperatur von 36-39 Grad werden die Öle nicht nur über die Nase, sondern auch die Haut aufgenommen.
Zur Vertiefung der Atmung im Falle von Kurzatmigkeit eignen sich:
- Latschenkiefer
- Fichtennadel
- Zirbelkiefer
- Tanne
- Pinie
- Cajaput
- Eukalyptus
- Minze
- Myrte
Ätherische Öle je nach Beschwerden sind:
- Zur Beruhigung und einer geringeren Adrenalinausschüttung passt Ylang-Ylang.
- Zur Entspannung eignet sich Lavendel. Dieser wird sogar effektiver über die Haut als die Nase aufgenommen.
- Bei Angstzuständen hat sich eine Mischung aus Lavendel, Orange, Neroli bewährt.
- Zur Unterstützung des Schlafes passt Jasmin.
Homöopathie & Globuli
Zur Behandlung von Klaustrophobie eignen sich im Bereich Homöopathie & Globuli:
- Argentum metallicum: metallisches Silber, das auf das periphere Nervensystem wirkt.
- Argentum nitricum: Silbernitrat (auch Höllenstein genannt); hilft u.a. gegen allgemeine Ängste; Prüfungsangst; Verdauungsbeschwerden; Schwindel; nervöse Herzbeschwerden.
- Kalium sulfuricum: Kaliumsulfat, das gegen Herbstdepression hilft und somit auch bei Klaustrophobie unterstützend wirken kann.
Homöopathische Mittel können unterschiedlich angewendet werden:
- In Tropfenform enthalten sie zur Konservierung Alkohol und sind somit weder für Kinder noch Alkoholkranke geeignet. Sie lassen sich jedoch gut dosieren.
- Es gibt homöopathische Mittel in Form von Tabletten und Pulver. Deren Grundlage ist jedoch Milchzucker, so dass sie für Menschen mit einer Laktoseintoleranz nicht bekömmlich sind.
- Die Globuli bestehen aus Zucker und dem homöopathischen Mittel. Es sind sehr kleine Kügelchen, die problemlos mitgeführt werden können.
Die Aufnahme der Wirkstoffe erfolgt über die Mundschleimhaut, so dass, unabhängig von der Zubereitungsart, Tropfen, Tabletten, Pulver oder Kügelchen für eine Minute im Mund verbleiben bzw. bei Bedarf im Mund zergehen sollten.
Die Potenzen der homöopathischen Mittel bzw. Globuli sind unterschiedlich und sollten bei Bedarf in der Apotheke erfragt werden.
Schüssler-Salze
Gegen die Klaustrophobie gibt es von den zwölf Schüssler-Salzen (Basissalze) das Kalium Sulfuricum, Schüssler-Salz Nr.6. Wer zur Ergänzung gegen diverse andere Probleme noch andere Schüssler-Salze benötigt kann sich diese zusammenstellen, da es möglich ist, mehrere an einem Tag einzunehmen.
 Schüssler-Salze kommen oft in Tablettenform, aber es gibt sie auch als Globuli und Pulver. Man lässt sie einzeln langsam im Mund zergehen. Die normale Dosierung ist eine dreimalige Gabe am Tag.
Schüssler-Salze kommen oft in Tablettenform, aber es gibt sie auch als Globuli und Pulver. Man lässt sie einzeln langsam im Mund zergehen. Die normale Dosierung ist eine dreimalige Gabe am Tag.
Dafür gibt es drei Möglichkeiten:
- 1-3 Tabletten
- 5-15 Globuli
- 1/2 bis 1 Teelöffel Pulver
Auch eine Hochdosierung ist möglich. Dabei nimmt man bis zu 100 Tabletten an einem Tag ein und lässt sie langsam im Mund zergehen.
Diät & Ernährung
Im Kontext der Klaustrophobie finden sich kaum sachdienliche Hinweise bezüglich einer günstigen Ernährung.
Wirft man jedoch einen Blick auf Ernährungshinweise, die sich im Kontext von Depressionen finden lassen, ist man ein gutes Stück weiter, da eine optimale Nährstoffversorgung dazu beitragen kann, dass nicht nur das Risiko an einer Depression zu erkranken gesenkt wird bzw. eine schon vorhandene depressive Erkrankung positiv beeinflusst wird, sondern dies sicherlich auch andere Psychische Erkrankungen positiv beeinflussen kann.
Alkoholika und sonstige Drogen sind prinzipiell für eine gesunde Psyche eine Herausforderung und sollten bei einer vorhandenen Klaustrophobie gemieden werden. Auch bei einer spezifischen Angsterkrankung ist das Gleichgewicht zwischen Seele, Geist und Körper von großer Bedeutung.
Dieses Gleichgewicht kann durch eine ausgewogene Ernährung unterstützt und gefördert werden. Auf den Patienten abgestimmte Nahrungsergänzungen bei diversen psychischen Erkrankungen könnten eine ideale Ergänzung zu verhaltens- oder psychotherapeutischen und psychopharmakologischen Behandlungen sein.
In einfacheren Fällen von Klaustrophobie könnte die Gabe von Medikamenten sogar ganz wegfallen.
FAQ – Fragen & Antworten
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Klaustrophobie.
Katastrophen – Ursächlich?
Ist die Anzahl klaustrophobisch Erkrankter von Katastrophen abhängig?
Dies ist durchaus so. Helfer in Erdbebengebieten, wo Menschen z.T. über Stunden und Tage eingesperrt waren, berichten immer wieder über Angst- und Panikzustände klaustrophobischer Art bei den Betroffenen.
Nur Symptome?
Warum wird bei einer Klaustrophobie nicht der gesamte Mensch, sondern nur die Symptome betrachtet?
Dies ist ein Problem, das nicht nur die Klaustrophobie, sondern psychische Erkrankungen im Allgemeinen betrifft. In Zukunft ist zu hoffen, dass sich Behandelnde nicht nur auf die Symptome, sondern den gesamten Lebenswandel konzentrieren. Dazu zählen u.a. das soziale Umfeld, die Ernährung, aber auch sportliche Aktivitäten.
Seit einigen Jahren gibt es jedoch auch Studien, wo bei der medikamentösen Behandlung von psychischen Erkrankungen mit Hilfe bildgebender Verfahren die genaue Verteilung der entsprechenden hormonellen Bestandteile im Gehirn (z.B. Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin) betrachtet wird und ein individueller medikamentöser Cocktail zusammengestellt wird, der auf die individuellen Bedürfnisse angepasst ist.
Bis diese Behandlung jedoch in der breiten Öffentlichkeit Anwendung findet und von den Krankenkassen bezahlt wird, können noch viele Jahre vergehen.
Gene oder Umwelt?
Ist die Klaustrophobie ein Resultat genetischer oder umweltbedingter Faktoren?
Die Antwort ist z.T. davon abhängig, wem man diese Frage stellt. Viele Genetiker präferieren verständlicher Weise genetische Gründe, wohingegen viele Psychologen und Pädagogen in erster Linie die Umwelt verantwortlich machen.
Neuere Untersuchungen inter- und transdisziplinärer Art ziehen jedoch eine Kombination beider Faktoren vor. Wer genetisch zu Ängstlichkeit und Vorsicht neigt und ggf. in einem Umfeld aufwächst, dass keine große Sicherheit bietet, kann im Zweifelsfall schneller an einer Klaustrophobie erkranken als ein Mensch mit einem sehr selbstbewussten Charakter, der in seinem Leben viel Unterstützung erfahren hat.
Hirn – Veränderungen?
Kommt es durch eine Klaustrophobie zu Veränderungen im Gehirn?
Sind Neurotransmitter (verschiedene Trägerstoffe) nicht im Gleichgewicht, kann dies Auswirkungen auf die Amygdala (Mandelkern) haben.
Die emotionale Bewertung von Ereignissen, wie bei der Klaustrophobie, hat Konsequenzen auf die Amygdala und ab einem gewissen Punkt ist die Reizschwelle, also Erregung für Situationen und Objekte so niedrig, dass eine Vielzahl von Reizen als gefährlich interpretiert wird. Die Klaustrophobie wird somit generalisiert.
Körpergedächtnis?
Reagiert das Körpergedächtnis auf die Klaustrophobie?
Das Körpergedächtnis ist das emotionale Gedächtnis und entsteht durch die Zusammenarbeit von Amygdala und Hippocampus, die bei Stress, also auch der Klaustrophobie, somatische Marker setzen. Dies passiert dann, wenn der Mensch nicht in der Lage ist, negativen Stress kognitiv aufzulösen.
Es lassen sich keine Strategien finden, um mit dem Erlebten konstruktiv umzugehen, so dass fortan das Körpergedächtnis versucht, den Menschen vor diesen oder ähnlichen Erfahrungen zu behüten. Daher reagiert der Betroffene nicht nur emotional in angstauslösenden Situationen, sondern auch körperlich.